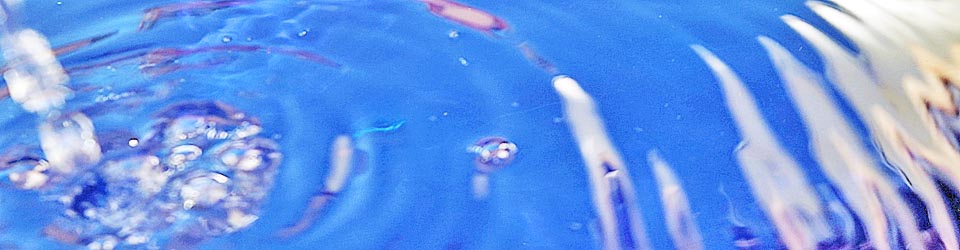von Andreas Peglau
Die noch immer – und nicht nur unter vielen kleinianischen und lacanschen Psychoanalytikern – verbreitete Auffassung, es gebe einen Todes-, Destruktions- oder zumindest einen, wie Konrad Lorenz postulierte, Aggressionstrieb, lässt sich mit guten wissenschaftlichen Argumenten bezweifeln.¹ Literatur dazu ist reichlich vorhanden.²
Bemerkenswert und meines Wissens wenig bekannt ist jedoch: Auch dem vielfach als Autoritätsbeweis für die Existenz angeborener Bösartigkeit herangezogenen Satz Sigmund Freuds liegt die krasse Fehlauslegung eines Zitates zugrunde.
In Das Unbehagen in der Kultur bemühte Freud 1930 den Ausspruch „Homo homini lupus“, zu Deutsch: „Der Mensch ist des Menschen Wolf“. Er setzte fort: „[W]er hat nach allen Erfahrungen des Lebens und der Geschichte den Mut, diesen Satz zu bestreiten?“ Der Mensch sei eine „wilde Bestie, der die Schonung der eigenen Art fremd ist“, beruhend auf einer „primären [!] Feindseligkeit der Menschen gegeneinander“ (Freud 1930, S. 471). Kein Zweifel also, dass Freud hier über Zwischenmenschliches urteilte.
Dabei bekümmerte ihn offenbar nicht, dass der englische Philosoph Thomas Hobbes (1588–1679), dem er – wie auch Freud-Biograf Peter Gay (2006, S. 614) unterstreicht – die lateinische Sentenz „Homo homini lupus“ entlehnte,³ dies mit einer gänzlich anderen Botschaft verknüpft hatte:
„Nun sind sicher beide Sätze wahr: Der Mensch ist ein Gott für den Menschen, und: Der Mensch ist ein Wolf für den Menschen; jener, wenn man die Bürger untereinander, dieser, wenn man die Staaten untereinander vergleicht. Dort nähert man sich durch Gerechtigkeit, Liebe und alle Tugenden des Friedens der Ähnlichkeit mit Gott; hier müssen selbst die Guten bei der Verdorbenheit der Schlechten ihres Schutzes wegen die kriegerischen Tugenden, die Gewalt und die List, d.h. die Raubsucht der wilden Tiere, zu Hilfe nehmen“ (https://de.wikipedia.org/wiki/Homo_homini_lupus).4
Zum einen bezog sich Hobbes mit der Wolfsmetapher also nur auf den Umgang von Staaten untereinander. Zum anderen urteilte er über das „durch Gerechtigkeit, Liebe und alle Tugenden des Friedens“ gekennzeichnete menschliche Miteinander ausgesprochen positiv – und damit diametral entgegengesetzt zu Freud.
Doch Freuds Satz begegnen wir bis heute immer wieder – und allermeist ohne kritische Reflektion seiner Quelle. Besonders gern wird er genommen, wenn es um die Rechtfertigung eines pessimistischen Menschenbildes und daraus abgeleiteter reaktionärer Schlüsse geht.
Auch der Historiker Jörg Baberowski, dessen Credo lautet, „Nur klare, regelkonforme und notfalls mit Gewalt durchsetzbare Machtverhältnisse können uns […] vor zügelloser Gewalt schützen“ (Baberowski 2016, Rückumschlag), beruft sich mehrfach auf Freud. Baberowski schreibt:
„Denn wo die Freiheit der Täter grenzenlos ist, ist auch ihrer Mordlust keine Grenze gesetzt. Der rechtsfreie Raum wird zur Hölle, sobald Menschen ihn in einen Gewaltraum verwandeln. ‚Homo homini lupus; wer hat nach allen Erfahrungen des Lebens und der Geschichte den Mut, diesen Satz zu bestreiten?‘, fragte Sigmund Freud. […]
Nur durch Abschreckung werden Menschen davon abgehalten, zu tun, was sie denken“ (ebd., S. 148).
Wer sich dagegen mit den realen Ursachen der gegenwärtig wieder anwachsenden Gewalt in den Beziehungen zwischen Individuen, Menschengruppen und Staaten auseinandersetzen möchte, findet weder hier noch in Freuds Todestriebmythologie konstruktive Ansatzpunkte.
Schon eher in Forschungen zur Sozialstruktur der – zumindest von Freud sicher wider besseres Wissen – als Inkarnation des Bösen deklarierten Wölfe. Das Vermeiden unnötiger Auseinandersetzungen und „die Schonung der eigenen Art“ sind für Wölfe offenkundig selbstverständlich. Von deren ausgeprägt sozialen und in Freiheit auf natürlicher Autorität beruhenden Zusammenleben5 könnten wir viel lernen. U. a. auch, dass in Tieren jener „Todestrieb“, den wir Menschen angeblich unvermeidlich mit uns herumschleppen, ohnehin nicht vorhanden ist.
*
Literatur:
Baberowski, Jörg (2016): Räume der Gewalt, Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung.
Bauer, Joachim (2011): Schmerzgrenze. Vom Ursprung alltäglicher und globaler Gewalt, München: Blessing.
Freud, Sigmund (1930) [1929]: Das Unbehagen in der Kultur, in ders.: GW Band 14, Frankfurt/M.: Fischer, S. 419–506.
Fromm, Erich (1989) [1974]: Die Anatomie der menschlichen Destruktivität, in ders.: Gesamtausgabe, Bd. 7, München: dtv.
Gay, Peter (2006) [1989]: Sigmund Freud. Eine Biographie für unsere Zeit, Frankfurt/M.: Fischer.
Hüther, Gerald (2003) [1999]: Die Evolution der Liebe. Was Darwin bereits ahnte und die Darwinisten nicht wahrhaben wollen, Göttingen: Vandenhoeck/Ruprecht.
Klein, Stefan (2011) [2010]: Der Sinn des Gebens. Warum Selbstlosigkeit in der Evolution siegt und wir mit Egoismus nicht weiterkommen, Frankfurt/M.: Fischer.
Reich, Wilhelm (1932): Der masochistische Charakter. Eine sexualökonomische Widerlegung des Todestriebes und des Wiederholungszwanges, Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse Bd. 18, S. 303–351.
Solms, Mark/Turnbull, Oliver (2004): Das Gehirn und die innere Welt. Neurowissenschaft und Psychoanalyse, Düsseldorf/Zürich: Walter.
Tomasello, Michael (2010): Warum wir kooperieren, Berlin: Suhrkamp.
Anmerkungen
(1) Die Absurdität der Todestriebhypothese hat bereits Wilhelm Reich aufgezeigt, beginnend mit seinem 1932 erschienenen Artikel Der masochistische Charakter. Eine sexualökonomische Widerlegung des Todestriebes und des Wiederholungszwanges. Die bei Weitem ausführlichste und schlüssigste Widerlegung dieser Hypothese bietet anhand zahlreicher Belege aus Psychoanalyse, (Sozial-)Psychologie, Paläontologie, Anthropologie, Neurophysiologie, Tierpsychologie und Geschichtswissenschaft Erich Fromms 1973 publizierte Anatomie der menschlichen Destruktivität. Auch die moderne Neurobiologie und -psychologie hat die Vorstellung genetisch angelegter Destruktivität vielfach entkräftet und stattdessen eine angeborene Fähigkeit zu konstruktivem prosozialen Verhalten nachgewiesen. Auf diesem Hintergrund formuliert der Neurobiologe und Psychotherapeut Joachim Bauer (2011, S. 16) ganz zu Recht: Der Aggressions- bzw. Todestrieb ist „der große Flop der Psychoanalyse“.
(2) So z.B. in Hüther 2003; Solms/Turnbull 2004, S. 138ff., 148; Tomasello 2010; Klein 2011; Bauer 2011. Auch Erwin Wagenhofers 2013 veröffentlichte Filmdokumentation Alphabet – Angst oder Liebe widerlegt die Todestriebmythologie auf berührende Weise (http://www.alphabet-film.com/).
(3) Der römische Komödiendichter Titus Maccius Plautus wird oft auch im Zusammenhang mit diesem Satz genannt. Er schrieb: »Lupus est homo homini, non homo, quom qualis sit, non novit.« Übersetzung: „Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf; kein Mensch, wenn er nicht weiß, welcher Art (sein Gegenüber) ist“ (http://www.gavagai.de/zitat/antike/HHCA03.htm). Oder auch: „Denn der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, kein Mensch. Das gilt zum mindesten solange, als man sich nicht kennt“ (http://gutenberg.spiegel.de/buch/asinaria-1786/4). Auch hier also keinerlei grundsätzliche Verteufelung.
Wie freizügig Freud bei Bedarf mit dem Inhalt von Worten hantierte, zeigt auch sein Umgang mit dem von ihm selbst kreierten Wort „Urszene“. Siehe dazu mein Artikel „100 Jahre ‚Urszene'“.
(4) Ausführlicher als bei Wikipedia ordnet beispielsweise der Philosoph Lutz Geldsetzer (https://de.wikipedia.org/wiki/Lutz_Geldsetzer) den Ausspruch von Hobbes ein: „Hobbes macht in seiner Widmung des Buches ‚Vom Bürger‘ an den Grafen von Devonshire die Bemerkung, daß ‚sicher beide Sätze wahr sind: Der Mensch ist ein Gott für den Menschen, und: Der Mensch ist ein Wolf für den Menschen; jener, wenn man die Bürger untereinander, dieser, wenn man die Staaten untereinander vergleicht. Dort nähert man sich durch Gerechtigkeit, Liebe und alle Tugenden des Friedens der Ähnlichkeit mit Gott; hier müssen selbst die Guten bei der Verdorbenheit der Schlechten ihres Schutzes wegen die kriegerischen Tugenden, die Gewalt und die List, d.h. die Raubsucht der wilden Tiere, zu Hilfe nehmen‘. (ibid. S. 59). Der letztere Satz, daß der Mensch für den Menschen ein Wolf sei, ist bekanntlich zum geflügelten Wort geworden, und man hält ihn gewöhnlich für den Fundamentalsatz der Hobbesschen Anthropologie, wie wir schon eingangs zeigten. Der erstere Satz, daß der Mensch ein Gott für den Menschen sei, muß zu Hobbes Zeiten auch sehr verbreitet gewesen sein, denn Hobbes setzt voraus, daß auch der Graf von Devonshire ihn kannte. Man kann dem Kontext entnehmen, daß Hobbes ihn auf alte römische Sprüche zurückführte, wonach die Römer ihre ältesten Könige mit reißenden Wölfen verglichen, ihre kaiserlichen Herrscher aber, die ja den Titel ‚Divus‘ – der Göttliche – führten, ihnen im Zeichen der Pax Romana als Götter in Menschengestalt gegenübertreten sahen. Das paßt sicher ganz gut zu stoischem Denken und deshalb auch zu Hobbes, aber verbreitet war solche Einstellung nach der Renaissance eher durch die neuplatonische Anthropologie eines Nikolaus Cusanus, Marsilio Ficino und anderer, Diese hatten den Menschen als ‚kleinen Gott‘ definiert und sahen gerade darin seine ‚dignitas‘ – Würde – daß er, anders als die geschaffenen Engel oder die Tiere, sich selbst zu dem machen müsse, was er sein wolle. Und da könne er sich eben sowohl zu einem Gotte machen wie zu einem Tiere“ (https://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/philo/geldsetzer/homepag3.html).
(5) https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/saeugetiere/wolf/wissen/18742.html; https://chwolf.org/assets/documents/woelfe-kennenlernen/Int-Publikationen/Begriff-Alpha_DMech-2008_de.pdf.
Tipp zum Weiterlesen:
Mythos Todestrieb. Über einen Irrweg der Psychoanalyse