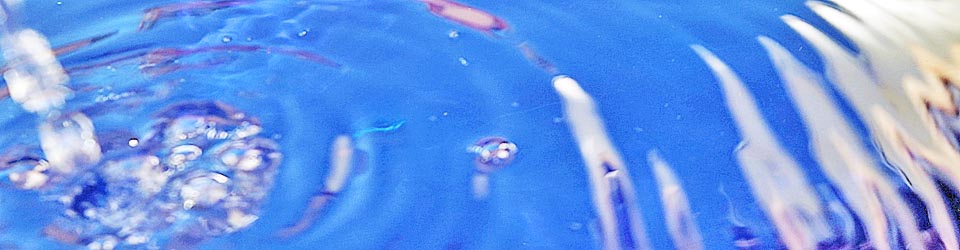Ein Vortrag über nützliche und schädliche Hilfe, deren psychische Basis sowie über reale und irreale Menschenbilder – von Andreas Peglau
*
Ich glaube, eine der wichtigsten Fragen, die heute steht, ist die, wie wir – von dem Ort aus, an dem wir jeweils leben – auf die Veränderungen reagieren, die unseren ganzen Planeten betreffen und allmählich auch jeden einzelnen, jede einzelne von uns beeinflussen werden. Längst begonnen hat das bei klimatischen Veränderungen: Das Wetter auch in unseren Breiten wird immer chaotischer, schwerer voraussagbar. Stürme und Überschwemmungen nehmen weltweit zu, Wüsten breiten sich rasant aus. Die ökologische Krise ist am Kommen.
Auch das soziale Klima schlägt um. Die Entstehung einer Weltwirtschaft unter kapitalistischen Vorzeichen sorgt schon jetzt für eine zunehmende Vereinheitlichung der Arbeits- und Lebensbedingungen – was von der BRD aus betrachtet heißt: auf fallendem Niveau. In Zukunft können die elenden Lebensbedingungen in fernen Ländern zum Vorbild für die Lebensbedingungen hierzulande werden.
Hilfe im Sinne von gezieltem Ausüben eines positiven Einflusses tut also auch im eigenen Interesse not. So miteinander verknüpft, wie heute alles ist, wird jede Hilfe für andere immer mehr auch zu einer Hilfe für uns selbst. Hilfe wird von einer freiwilligen Tugend einiger zu einer Notwendigkeit für alle.
Aber wie können wir hilfreich einwirken auf diese Geschehnisse?
Ich will nicht den Versuch machen, die Frage zu beantworten, was einzelne Menschen konkret tun können. Stattdessen geht es mir um allgemeine Voraussetzungen dafür, daß eine solche Hilfe überhaupt sinnvoll ist.
Aber ist Hilfe nicht sowieso immer sinnvoll? Ist Helfen nicht immer etwas Gutes und Wünschenswertes?
Ich glaube nicht, daß sich diese Frage so einfach bejahen läßt.
Was sind denn typische Beispiele für Hilfe, wie wird normalerweise geholfen?
Durch freundschaftliche Gespräche, durch Medikamente, durch Psychotherapie, durch Sozialarbeit, durch Arbeitslosengeld, durch Geldspenden für die „Dritte“ Welt, durch wissenschaftliche Entdeckungen, die globale Probleme wie die weltweite Energiekrise lösen sollen.
Aber wird hier tatsächlich unbedingt ein positiver Einfluß ausgeübt?
Freundschaftliche Gespräche können bei Eheproblemen hilfreich sein, aber sie können auch dazu führen, daß sich jemand immer nur bei Freunden ausheult, statt seine Probleme mit demjenigen zu klären, den es eigentlich betrifft. Medikamente können vorübergehend Schmerzen abblocken, mittelfristig süchtig machen und langfristig schwerste Gesundheitschäden hervorrufen. Psychotherapie kann ein Hilfsmittel sein gegen Autoritätshörigkeit, aber sie kann unter Umständen auch zu einer neuen autoritären Abhängigkeit führen – vom Therapeuten. Arbeitslosengeld hilft Menschen, materiell zu überleben und hält sie gleichzeitig in demütigender Abhängigkeit vom Staat. Sozialarbeit kann Not lindern – aber auch als Alibi dienen, um die Ursachen der Not nicht angehen zu müssen. Die Ernährungshilfe für Afrika kann dazu mißbraucht werden, politische Systeme zu erhalten, die den Hunger erst hervorrufen. Und: Eine der einflußreichsten wissenschaftlichen Entdeckungen auf dem Energie-Sektor – die Atomenergie – steht in dringendem Verdacht, selbst bei friedlicher, störungsfreier Nutzung schwere Schäden am Ökosystem der Erde auszulösen.
Was als Hilfe gemeint ist oder bezeichnet wird, kann also grundverschiedene Wirkungen haben, letztlich sogar schädlich sein.
Ich bin der Meinung: Eine der entscheidenden Voraussetzungen für die Wirkung der Hilfe ist das Bild, die Vorstellung, die der Helfer oder die Helferin von denen hat, denen geholfen werden soll. Wollen wir der Welt helfen, brauchen wir ein reales Bild von ihr. Wollen wir Menschen helfen, brauchen wir ein reales Bild von ihnen.
Ich will zunächst am Beispiel der zwischenmenschlichen Hilfe zeigen, daß verschiedene heute gängige Menschenbilder zu ganz verschiedenen Hilfsvorschlägen führen – und anschließend mein eigenes Menschenbild und dessen Konsequenzen für die Hilfe von Mensch zu Mensch erklären.
Was ist das: ein Menschenbild?
Meiner Meinung nach kein bloßes Tummelfeld von Philosophen oder sonstigen professionellen Denkern, sondern etwas, das jeder und jede von uns hat. Es ist die Summe von – bewußten oder unbewußten – Erwartungen und Annahmen darüber, wie Menschen im allgemeinen sind: Ob sie gut sind oder böse, lernfähig oder nicht, zuverlässig oder unzuverlässig, was Menschen empfinden können, unter welchen Umständen sie sich wohlfühlen, wann sie glücklich oder traurig sind, wie sie in einer bestimmten Situation reagieren, wodurch und wie weit Menschen beeinflußt werden können usw.
Menschenbilder haben bei vielen Menschen, die zusammen in einer Gesellschaft leben, gemeinsame Züge. Trotzdem existieren auch immer ganz verschiedene Menschenbilder nebeneinander. Ein (leider im mehrfachen Wortsinn) brandaktuelles Beispiel dafür ist die Einstellung gegenüber sogenannten Rechtsradikalen und die Vorstellungen darüber, wie mit ihnen umgegangen werden soll, wie also die Gesellschaft dem Problem Rechtsradikalismus Abhilfe schaffen soll.
Ich will zunächst drei Meinungsäußerungen sinngemäß wiedergeben aus einer Zeitungsumfrage zum Thema „Was kann man gegen Rechtsradikalismus tun?“ (Berliner Zeitung vom 26.11.1993) und sie kurz interpretieren.
Der damalige Jugendstadtrat des Berliner Stadtbezirks Treptow Joachim Stahr (CDU) bot in dieser Umfrage als Lösung an: „Gewaltbereite Jugendliche müssen wieder an Recht, Ordnung und Leistungsbereitschaft gewöhnt werden.“
Das verstehe ich so: Diese Jugendlichen haben bestimmte gesellschaftliche Normen nicht verinnerlicht. Diese Normen müssen ihnen jetzt, notfalls mit Zwang, wieder beigebracht werden.
Dabei setzt der Stadtrat offenbar stillschweigend voraus:
- Das geltende BRD–Recht wird allen und allem gerecht, die hier herrschende Ordnung ist die beste, die möglich ist, das Leistungsprinzip steht sowieso nicht zur Debatte. Kurz: Diese Gesellschaft und ihre Normen sind gut und könnten im Prinzip besser nicht sein. Sie sind sogar so gut, daß sie – einmal richtig verinnerlicht – Radikalismus und Gewalt verhindern. Also ist es richtig, Menschen zu zwingen, sich an diese bestehenden Normen anzupassen.
- Nur das „Hier und Jetzt“, nur die Gegenwart ist von Bedeutung. Tiefergehende Motive, langfristig entstandene Einstellungen, Einflüsse der Lebensgeschichte – der Eltern und Lehrer beispielsweise – sind unbedeutend. Es ist daher völlig ausreichend, das aktuelle Verhalten der Jugendlichen zu verändern.
Dieses Menschenbild ähnelt der Auffassung einer der – auch hierzulande – gängigsten psychotherapeutischen Richtungen: der Verhaltenstherapie: Nur das Verhalten selbst, die äußerlich sichtbare Störung – in diesem Fall die Gewalt – ist das Problem. Es reicht deshalb aus, dieses äußerliche Verhalten zu manipulieren und den „Verhaltensgestörten“ wieder die geltenden guten Normen draufzudrücken, bzw. ihnen durch Strafen ihre bösen Verhaltensweisen wegzumachen.
Dieses Modell entspricht im Prinzip den Rattenversuchen, bei denen den Versuchstieren erwünschtes Verhalten durch Belohnung – z.B. Nahrung – anerzogen wird bzw. unerwünschtes Verhalten durch Bestrafung – z.B. Stromstöße – „abgewöhnt“ wird.
Zweites Beispiel. Rita Süßmuth (SPD) forderte in derselben Umfrage: „Die Bevölkerung soll den Gewalttätern entschlossen entgegentreten.“
Aus diesem Satz schließe ich: Es gibt die „gute“ Bevölkerung, also die an sich ausländerfreundlichen deutschen Massen und die wenigen üblen Radikalen. Wenn daher sich die 99 Prozent der Deutschen zu ihrer Menschlichkeit bekennen, wird das eine Prozent von radikalen Außenseitern abgeschreckt werden und sein Streben als sinnlos aufgeben.
Das halte ich für ein naives Menschenbild, etwa auf dem Erkenntnisstand der Märchen der Gebrüder Grimm: Gut und Böse sind sauber geschieden und dazwischen klafft ein tiefer, unüberwindlicher Graben. Und natürlich ist das Gute viel stärker als das Böse.
Drittes Beispiel. Helmut Kohl (CDU) zum selben Thema: „Gewalt muß in der Gesellschaft Tabu sein. Es kann keine Rechtfertigung für Gewalt geben.“
Das interpretiere ich so: Gewalt und Aggression ist für ihn immer und in jeder Form etwas Schlechtes, Verabscheuungswürdiges. Dabei ignoriert er, daß Aggression im ursprünglichen Wort–Sinne bedeutet: Auf-etwas-zu-Gehen, Etwas-in-Angriff-Nehmen. Ohne diese Art von notwendiger, gesunder Gewalt könnte kein Mann beim Geschlechtsverkehr in eine Frau eindringen, kein Baby könnte sich durch einen engen Geburtskanal zwängen, kein angegriffener Mensch könnte wirkungsvoll sein Leben verteidigen. Helmut Kohl sieht sich, obwohl selbst Vertreter der Staatsgewalt, offenbar nicht in der Lage, zwischen dieser lebensnotwendigen Gewalt einerseits und einem rein zerstörerischen, sadistischen Töten und Verletzen zu unterscheiden. Stattdessen ist Gewalt für ihn etwas so Allgegenwärtiges, Bedrohliches, daß er ein allgemeinverbindliches Tabu für notwendig hält, um sie zu bannen. Das kommt mir vor wie ein heidnisches Beschwörungsritual. Und wie eine Ohnmachtserklärung.
Denn Tabu heißt ja gleichzeitig: Bearbeiten oder an der Wurzel packen läßt sich das ohnehin nicht, also nur nicht dran rühren, möglichst nicht einmal davon sprechen. Scheinbar wird hier davon ausgegangen, daß Menschen nun mal schlecht sind und sie bestenfalls lernen können, ihre Schlechtigkeit zu unterdrücken: Wenn wir nicht den Anfängen wehren, dann gerät alles außer Kontrolle!
Bereits bei diesen drei Beispielen zeigt sich: Verschiedene Menschenbilder führen zu verschiedenen Lösungsvorschlägen für menschliche Probleme.
Dasselbe gilt im privaten Bereich. Wenn ich der Meinung bin, Kinder kommen als unbeschriebene Blätter auf die Welt, denen die Erwachsenen erst sämtliche Regeln des Zusammenlebens beibringen müssen, dann werde ich mich anders verhalten, als wenn ich an das angeborene Böse, Asoziale, Selbstsüchtige im Menschen glaube und diese Züge deshalb von Anfang an unterdrücken will.
Zu wieder anderen Vorgehensweisen führt die Annahme, Menschen würden allein durch ihre bewußten Absichten und Ansichten gelenkt, wir würden sämtliche Motive unseres Handelns kennen, immer wissen, was wir tun und warum wir es tun.
Als Familienhelfer bin ich zum Beispiel in der folgenden Situation damit konfrontiert worden, wie unzureichend diese Annahme ist: Ich hatte auf die Mitarbeit eines fünfzehnzehnjährigen Jungen und seiner alleinstehenden Mutter gehofft. Beide litten nach eigenen Angaben sehr unter ihren heftigen Konflikten und wünschten sich endlich etwas Ruhe voreinander. Es gab keinen Grund, an der Ehrlichkeit der mir mitgeteilten Verzweiflung zu zweifeln. Außerdem bestand für den Jungen – wenn sich nichts ändern würde – die Gefahr einer Heimeinweisung. Und ich dachte, das wäre unvorstellbar für ihn.
Aber für den Jungen war es offenbar noch unvorstellbarer, den Konflikten mit seiner Mutter tatsächlich aus dem Weg zu gehen. Und die Mutter verhielt sich ebenso. Stück für Stück merkte ich, daß beide geradezu an ihren ständigen Streitereien klebten. Beide wollten sich nicht wirklich mehr gegenseitige Freiheit zugestehen.
Die Mutter war zum Beispiel auf Dauer nicht zu bewegen, ihre Kleider aus dem Schrank des Sohnes herauszuholen, obwohl sie deshalb ständig in sein Zimmer mußte und bei dieser Gelegenheit regelmäßig über die dort herrschende Unordnung in Tobsuchtsanfälle ausbrach. Der Sohn war nicht bereit, auf Dauer den eigenen Fernseher in seinem Zimmer zu benutzen. Notfalls zerlegte er ihn sogar, um anschließend wieder im Zimmer der Mutter fernzusehen und dabei die obligatorischen Verwüstungen zu hinterlassen, die mit absoluter Sicherheit sofort nach Eintreffen der Mutter zu wüsten Beschimpfungen führten. Usw.
Das heißt, während sie bewußt unter ihren Konflikten litten, hielten sie gleichzeitig unbewußt an ihnen fest, organisierten diese Konflikte sogar immer wieder aufs Neue in einer Art Wiederholungszwang. Offenbar verschafften ihnen ihre Auseinandersetzungen sogar Halt und eine gewisse Geborgenheit.
Zugespitzt: Sie blieben nicht trotz ihrer Konflikte beieinander, sondern wegen ihrer Konflikte.
So jedenfalls interpretiere ich ihr Verhalten auf Grund meines Menschenbildes, auf das ich – wie gesagt – noch zu sprechen komme.
Nach einem knappen Jahr ging dann die Hilfe ohne anhaltende Veränderungen zu Ende.
Aber schon die bloße Tatsache, daß überhaupt eine konkrete Hilfe in Angriff genommen wird, setzt ein Menschenbild voraus: Annahmen darüber, wer als hilfsbedürftig, bedauernswert oder als krank gilt und wer nicht, wem geholfen werden kann und soll und wem nicht, wer sich selbst helfen kann und wer nicht.
Menschen, die sich streiten und prügeln zum Beispiel brauchen nach allgemeiner Auffassung wahrscheinlich eher Hilfe als Menschen, die Abend für Abend gemeinsam wortlos vor dem Fernseher sitzen. Oder als Rentner–Paare, die ganztägig aus den Fenstern ihrer Wohnung sehen – allerdings er auf der Südseite und sie auf der Nordseite. Kranke erregen mehr Hilfsbereitschaft als „Arme“, auch dann, wenn deren subjektives Elend durchaus zu vergleichen wäre. Aber Krankheit gilt zumeist als ohne eigene Beteiligung von außen kommend, Armut eher als selbst verschuldet und vermeidbar.
Ein anderes Beispiel für die in unserer Gesellschaft übliche Hierarchie der Hilfsbedürftigkeiten: Für scheinbar „rein körperlich“ Erkrankte stellt dieser Staat einen viel umfangreicheren und viel kostengünstigeren Teil des Gesundheitssystems zur Verfügung als für Menschen mit schwerwiegenden seelischen oder „geistigen“ Problemen. Das ist zwar Diskriminierung. Aber es ist zumindest weit entfernt vom Euthanasie-Massenmord im „Dritten Reich“, der ja seinerzeit von einigen ebenfalls völlig ernsthaft als Hilfe eingestuft wurde: für Menschen, denen das Leben angeblich nur noch eine Qual sein sollte. Wieder andererseits wären in anderen Kulturen manche Menschen, die wir heute als „geisteskrank“ einstufen und mit Vorliebe in Anstalten sperren, für heilig gehalten worden und bevorzugt behandelt worden.
Kurz: Es existieren nicht nur gleichzeitig in der Gegenwart verschiedene Menschenbilder, auch die Vergangenheit ist voll von zusätzlichen Alternativen.
Mein Menschenbild
Ich möchte jetzt das Menschen-Bild zur Diskussion stellen, das mir gegenwärtig am realsten vorkommt. Dazu will ich noch einmal auf die – im negativen Sinne – gewaltbereiten Jugendlichen zurückkommen.
Eine Idee, wie mit ihnen umgegangen werden könnte, ist eher in religiösen Kreisen anzutreffen, als bei Politikern – nämlich sie als Menschen mit Problemen anzusehen, als Menschen, die Hilfe brauchen und vor allem: Liebe. Die christliche Variante davon klingt dann zum Beispiel so, daß „nur die vergebende Macht der Liebe die aggressive Macht des Bösen überwindet.“ Fernöstlich betrachtet, zum Beispiel als Buddhist, wird der Schwerpunkt mehr darauf gelegt, durch Anteilnahme und Liebe dafür zu sorgen, daß sogenannte negative Gefühle wie Haß und Wut verschwinden, daß wir lernen, sie zu unterdrücken oder uns von ihnen abzulenken.
Mit beiden Sichtweisen habe ich Probleme. Aber der Standpunkt, durch Liebe zu helfen, ist mir sehr sympathisch. Allerdings denke ich, er reicht nicht aus.
Erstens geht er zumeist von einer ständig vorhandenen, umfassenden Liebesfähigkeit des Helfenden aus. Wenn also Liebe als Hilfe angeboten wird, dann steht damit meiner Meinung nach die Frage im Raum: Welcher helfende Mensch kann wirklich so viel Liebe empfinden und geben, wie da gebraucht wird? In unserer gefühlsunterdrückenden Kultur halte ich das für ausgesprochen selten. Ist diese angebotene Liebe und Zuwendung aber nicht echt, sind nicht sowohl Kopf als auch Herz – oder meinetwegen „Bauch“ – daran beteiligt, dann erfahren die Jugendlichen nur aufs Neue das, was ihre Wut schon mit verursacht haben dürfte: Heuchelei und Verlogenheit.
Die zweite Frage lautet: Können diese haßerfüllten Jugendlichen denn Liebe so einfach annehmen? Ich denke, nein.
Der Psychotherapeut Hans–Joachim Maaz hat das sinngemäß so auf den Punkt gebracht: Es ist eben nicht damit getan, gedemütigten Menschen aus einer kaputten Familiensituation nur Zuneigung, Verständnis und Hilfe anzubieten – es müssen Möglichkeiten geschaffen werden, die Aggression herauszulassen. Solange der vorhandene Stau an aggressiven Gefühlen nicht abgebaut wird, so Hans–Joachim Maaz, solange prallt jede Liebe an den Mauern des berechtigten Hasses ab.
Eine ganz ähnliche Auffassung praktisch umgesetzt hat der schottische Pädagoge Alexander Neill in seiner Summerhill–Schule, einmal auch in der Weise, daß er einem neuhinzugekommenen Jugendlichen nicht nur erlaubte, Fensterscheiben einzuwerfen, sondern selber dabei mitmachte.
Was für ein Bild vom Menschen steckt dahinter?
Zunächst einmal die Annahme, daß es einen berechtigten, sinnvollen Haß gibt. Dementsprechend wäre es falsch, diesen nur zu unterdrücken oder sich nur von ihm abzulenken.
Zweite Annahme: Dieser Haß entstammt der Lebensgeschichte der Jugendlichen, das heißt, gegenwärtig ist er nicht – oder jedenfalls bestimmt nicht in vollem Umfang – berechtigt. Nur an der aktuellen Situation gemessen, wirkt er überzogen oder völlig sinnlos. Seine eigentliche Berechtigung hatte er aber zu früheren Zeiten, in anderen Situationen. Damals konnte er jedoch nicht ausgedrückt werden. Daher staute er sich an, immer mehr, so wie sich in einem beheizten Dampfkessel immer stärker ein innerer Druck aufbaut. Dieser Druck wird jetzt, in der Gegenwart, so übermächtig, daß er unbedingt ein Ventil braucht. Dazu eigenen sich am besten schwächere, wehrlose Menschen oder Objekte – zum Beispiel Fensterscheiben oder in unserer Gesellschaft: Ausländer.
Dritte Annahme: Die frühere Situation, in der dieser Haß anfing zu wachsen, läßt sich unter dem Begriff Erziehung zusammenfassen. Die Personen, die diesen Haß erst haben entstehen lassen, sind also in erster Linie die üblichen Erziehungspersonen: Eltern, Angestellte von Krippen, Kindergärten oder – heute – Kindertagesstätten, Lehrer und Lehrerinnen.
Wie haben sie diesen Haß entstehen lassen? Indem sie zum einen die vorhandenen natürlichen Bedürfnisse der Kinder nur unzureichend befriedigt haben und zum anderen die Kinder vielfach nach gefühlsunterdrückenden, entfremdenden Normen erzogen haben. Überspitzt gesagt: Das, was Kinder brauchen, bekommen sie nicht – aber dafür wird ihnen jede Menge Mist eingetrichtert, der sie ihr Leben lang zu seelischen Krüppeln machen kann.
Diese Erzieher existieren aber nicht losgelöst von der Gesellschaft, sondern sie haben sogar von ihr einen Erziehungsauftrag, sind selbst von dieser Gesellschaft geformt worden. Das bedeutet ja auch, daß sie nicht etwa nur ihre Privatnormen an die Kinder weitergeben, sondern Normen, die in unserer Gesellschaft allgemeinverbindlich sind. Und diese Normenweitergabe erfolgt ja nicht nur bei denen, die später als Rechtsradikale eingestuft werden, sondern im Prinzip bei allen Kindern.
Daher die vierte Annahme: Die Gefühls– und Bedürfnisunterdrückung, die für unsere Gesellschaft typisch ist, macht die allermeisten von uns zu potentiellen Gewalttätern.
Nur die wenigsten leben das öffentlich aus, es sei denn, sie gehören zu Berufsgruppen wie Polizei oder Militär. Normalerweise wird diese Gewaltbereitschaft entweder indirekter oder versteckter sichtbar: Gegen die eigenen Kinder, den eigenen Partner, die eigene Partnerin, gegen Konkurrenten in der Arbeit, gegen andere Straßenverkehrsteilnehmer, gegen Tiere und gegen die Natur im Allgemeinen. Oder – zum Beispiel in Form von Drogenabhängigkeiten oder psychosomatischen Krankheiten – gegen sich selbst.
So betrachtet, sind die gewalttätigen Jugendlichen keine wirklichen Außenseiter, keine echte Randgruppe der Gesellschaft. Sie sind nur die langsam abtauende Spitze des Eisbergs aus festgefrorenem Haß.
Anders formuliert: Sie sind die Symptomträger für eine grundsätzliche Störung unserer Gesellschaft. Etwa so, wie eine Krebserkrankung, die längst den ganzen Körper erfaßt hat, sich zunächst in örtlich begrenzten Geschwüren zeigt. Und ich kann mir einbilden, ich würde die ganze Krankheit kurieren, wenn ich diese Geschwüre herausschneide. Aber das ist ein Irrtum.
Das heißt natürlich auch: Ohne umfassende gesellschaftliche Veränderungen wird es kein Ende von Rechts-, Links- und sonstigem Radikalismus und von destruktiver Gewalt, auch nicht von Umweltzerstörung geben.
Ich möchte mein Menschenbild noch einmal auf eine andere Weise erklären.
Wir Menschen kommen – so stellte schon Wilhelm Reich fest – auf die Welt mit natürlichen Grundbedürfnissen nach Liebe, Zuwendung, Kontakt und mit der Fähigkeit, mit der Gesamtheit unserer Gefühle – mit Liebe, Freude, Trauer, Wut und Haß, also auch mit Aggression – in entsprechenden Situationen angemessen zu reagieren. Das heißt, wir sind eben keine unbeschriebenen Blätter, sondern wir bringen alle Voraussetzungen mit, um in einer gesunden Gesellschaft auch gesund leben zu können. Wir haben sogar etwas wie einen inneren Kompaß, ein Gespür dafür, was gut für uns ist: die Möglichkeit einer Selbststeuerung oder Selbstregulation. Wir fühlen sehr genau, was wir brauchen, ob an Nahrung oder an Zuwendung. Und wir brauchen immer – lebensnotwendig – andere Menschen. Ein „asozialer“ Säugling ist also überhaupt nicht denkbar bzw. nicht lebensfähig.
Schon unser Bedürfnis nach Liebe können wir jedoch als Neugeborene nicht umfassend befriedigen oder auch nur umfassend zum Ausdruck bringen – die normale Erziehung und Lebensweise in unserer Kultur läßt dafür nur ungenügend Raum. Bereits dieses Grundbedürfnis bleibt also zumeist unbefriedigt in uns stecken: Wir sind viel zu oft allein, haben zu wenig Körperkontakt, unsere Bezugspersonen sind selbst nur begrenzt liebesfähig, werden von stressigen Partnerschafts- und Arbeitsbeziehungen aufgesaugt usw. usf.
Als verständliche Reaktion darauf entsteht eine existentielle Angst, Enttäuschung, Wut, Haß. Und natürlicherweise wollen wir auch das wieder ausdrücken, mitteilen, durch Schreien, Weinen oder Trotz, um diese schreckliche Situation zu verändern. Aber auch dieser Versuch scheitert zumeist. Er wird ignoriert oder sogar bestraft. Auch diese Gefühle stauen sich also an. Mit jeder neuen Erniedrigung in der Krippe, im Kindergarten, in der Schule und in jeder weiteren Unterdrückungssituation, auf die wir nicht angemessen reagieren dürfen, steigt der Pegel in diesem Staubecken höher und höher.
Und da der Haß sich bei Strafe nicht gegen seine übermächtigen Verursacher wenden kann, wird dieser Haß ins Unbewußte verdrängt. Es ist uns nicht mehr bewußt, daß wir hassen und wen wir hassen. Auf diese Weise ist der Haß nun auch nicht mehr an bestimmte Personen gebunden. Er kann nach weniger starken Ersatzobjekten suchen – von den Fliegen, denen die Flügel ausgerissen werden, über schwächere Mitschüler zu den jeweils landestypischen Feindbildern des Erwachsenendaseins: Kapitalisten, Kommunisten, Ausländer, Juden, Araber, Fundamentalisten, Linksradikale, Rechtsradikale, Liberale, Schwule, Reiche, Arme, „Kluge“, „Doofe“, Frauen, Männer, Kinder, oder auch die gesamte Natur, die wir uns „untertan zu machen haben“ …
So wird gleichzeitig aus den angemessenen, gesunden Aggressionen des Säuglings immer mehr die scheinbar ziellose und sinnlose Destruktivität des Durchschnittserwachsenen in unserer Kultur.
Aber mein Menschenbild ist noch nicht vollständig. Also nochmal zurück in die frühe Kindheit.
Wir müssen ja in Kontakt zu unseren Eltern kommen, um zu überleben. Mit Liebe und Protest hat es nicht funktioniert. Aber wie dann?
Das einzige, was uns als Ausweg gelassen wird, ist, jene Verhaltensweisen an den Tag zu legen, die akzeptiert und gewollt sind: Wir werden brav oder drollig oder artig und später dann nett oder höflich oder fleißig – oder hilfsbereit. Oder alles zusammen. Am Ende ist von uns jedenfalls nur noch das zu sehen, was die Gesellschaft toleriert: Eine Maske aus normengerechtem Verhalten.
Das heißt auch: Die äußerste, oberflächliche Schutzschicht, die wir tagtäglich zur Schau tragen, bleibt nur bestehen zum Preis ständiger seelischer Anstrengungen, mit denen wir den inneren Druck niederhalten. Denn unter dieser Schutzschicht brodelt ja ein Hexenkessel voll destruktiver Gefühle, die den einengenden Panzer am liebsten sprengen möchten oder wenigstens durch löchrige Stellen vorübergehend Dampf ablassen wollen. Für viele sind zum Beispiel der Alkohol oder andere Drogen eine derartige Möglichkeit und ein Alibi, endlich mal „die Sau rauszulassen“.
Und das Feuer unter diesem Hexenkessel, die Energie, die ihn unter Dampf hält, ist unser noch niemals vollständig befriedigtes Bedürfnis nach Zuwendung und Kontakt.
So gesehen lassen sich die brutalen Aktionen mancher Radikaler auch verstehen als pervertierter Schrei nach Liebe.
Daß es eigentlich darum geht, lieben zu dürfen und geliebt zu werden und die eigenen Gefühle endlich umfassend ausdrücken zu können, das ist – so Hans-Jochaim Maaz – sozusagen das tiefste, am besten gehütete Geheimnis in uns. So gut gehütet, daß wir es selbst kaum noch ahnen.
Und nicht nur unsere Liebesfähigkeit ist tief verschüttet. Bei diesem ganzen Anpassungs- oder besser Unterwerfungsprozeß, der Erziehung genannt wird, verschwindet auch immer mehr unsere ursprüngliche Fähigkeit zur Selbstregulation, zur Selbststeuerung. Statt dessen, was für uns gut ist, machen wir das, wovon andere behaupten, daß es gut für uns wäre. Und das reicht vom Streben nach guten Zensuren bis zum Heldentod.
Das ist – grob zusammengefaßt – mein gegenwärtiges Menschenbild. (Vor ein paar Jahren hätte ich das noch ganz anders gesehen.) Wenn dieses Menschenbild die Realität einigermaßen real widerspiegelt, dann hat das entsprechende Konsequenzen für den Umgang mit Gewalttätern – aber nicht nur dafür.
Welcher Hilfsvorschlag leitet sich aus diesem Menschenbild ab?
Allgemein gesagt: den „guten Kern“ freischaufeln!
Konkreter will ich das noch einmal am Beispiel der sogenannten rechtsradikalen Jugendlichen erklären: Die angepaßte Maske, von der ich gesprochen hatte, ist den jugendlichen Gewalttätern ja offenbar teilweise schon abhanden gekommen. Was ihr Verhalten weitgehend bestimmt, ist vielmehr der mörderische Haß der „Zwischenschicht“. Erst wenn sie die Möglichkeit haben, sich bewußt zu machen, wen sie eigentlich meinen mit diesem Haß, wenn sie diese Gefühle wenigstens im Nachhinein symbolisch an die richtige Adresse richten können, und wenn sie den ursprünglichen Schmerz darüber, noch niemals ausreichend geliebt worden zu sein, zulassen und ertragen können – erst dann werden sie mit aktuellen Angeboten an Liebe und Zuwendung wieder etwas anfangen können, erst dann werden sie selbst wieder lieben können statt immer nur hassen.
Die sinnvollste Hilfe wäre also, ihnen einen Raum zur Verfügung zu stellen und einen kompetenten Begleiter, der sie dabei unterstützt, sich zu erinnern und das auszudrücken – mit Worten und mit dem Körper – was sie damals nicht ausdrücken konnten.
Die gebräuchlichste Bezeichnung für einen solchen Vorgang ist: Therapie.
Allerdings nicht irgendeine Therapie. Auf jeden Fall muß es eine Hilfeform sein, die die lebensgeschichtlichen Ursachen des gegenwärtigen Verhaltens mit einbezieht: Wo kommt es her, warum ist es entstanden?
Für völlig ungeeignet halte ich dagegen Versuche, nur oberflächliche Verhaltenskorrekturen herbeizuführen und die Quelle der Wut dabei unangetastet weitersprudeln zu lassen. Das wäre auf Dauer genauso verheerend, wie einen Gehirntumor jahrelang mit Kopfschmerztabletten zu behandeln oder bei einer Autoreparatur nur Bremsflüssigkeit nachzukippen, wenn eine Bremsleitung ein Loch hat.
Eine solche Therapie zu beginnen und durchzuhalten, dazu reicht allerdings sicher nicht die rein rationale Erkenntnis, daß es gut für mich wäre – dafür ist diese Auseinandersetzung mit sich selbst viel zu anstrengend, zu langwierig und zu schmerzlich. Und es wäre auch sinnlos, einen Rechtsradikalen zu einer solchen Therapie gerichtlich zu „verurteilen“. Notwendige Voraussetzung für diese Therapie ist soetwas wie ein „Leidensdruck“: das Bewußtsein, daß es mir schlecht geht – oder wenigstens längst nicht so gut, wie ich es mir wünsche –, daß ich heftige Probleme habe, daß sich etwas ändern muß. Vor allem: daß ich mich ändern muß.
Ich glaube aber auch da wieder, daß dieser Leidensdruck in den allermeisten von uns, also auch in den Rechtsradikalen, zumindest unbewußt vorhanden ist: Die meisten von uns leiden an mehr oder weniger unbefriedigenden Partnerbeziehungen, an mehr oder weniger entfremdeter Arbeit, an mangelnden intensiven Kontakten zu Freunden und Kollegen, an nicht oder nur unzureichend vorhandenem Lebenssinn, an einer immer mehr kaputtgehenden Natur und an vielem anderen.
Wenn wir uns das bewußt machen, und wenn wir uns daran erinnern, daß wir in vieler Hinsicht einmal ganz andere Träume von unserem Leben hatten, daß wir eigentlich tief drinnen ganz genau wissen, wie sehr unsere gegenwärtige Lebensweise diesen Träumen zuwiderläuft – dann kann sich der Weg zu Veränderungen ein Stück öffnen.
Gibt es einen „guten Kern“?
Grundlage für diese optimistischen Annahmen über die Veränderbarkeit von Menschen war die Idee eines inneren gesunden Maßstabes, eines „guten Kerns“. Aber gibt es das wirklich? War die Welt nicht schon immer schlecht, waren die Menschen nicht im Prinzip schon immer so hilflos, ängstlich, uninteressiert oder böse wie heute?
Ich will abschließend sechs Gegenargumente nennen. Die ersten drei sind ausführlich dargestellt in Erich Fromms Buch Anatomie der menschlichen Destruktivität.
1. Die Forschung zu Menschenaffen
Destruktives Verhalten, gehäufte Kämpfe bis hin zu wiederholten Verletzungen oder sogar Tötungen von Artgenossen lassen sich zwar in zoologischen Gärten immer wieder beobachten. In freier Wildbahn kann davon aber keine Rede sein. Im Gegenteil, hier fällt das ausgeprägt soziale Verhalten der Affen auf, der oft spielerische und teilweise sogar recht zärtliche Umgang miteinander.
Von unseren Vorfahren im Tierreich läßt sich also nicht auf eine destruktive Anlage schließen, die die menschliche Gattung mitbekommen hätte.
2. Menschheitsgeschichte
Eine Vielzahl archäologischer Funde, zum Beispiel in der anatolischen Siedlung Catal Hüyük, sowie kulturgeschichtliche und sozialwissenschaftliche Untersuchungen beweisen, daß ein so destruktives Verhältnis zur Natur und zwischen den Menschen erst 4 – 6 000 Jahre alt ist, und das zuvor sehr viel mehr Jahrtausende lang eine lebensbejahendere, auf ausgeprägterer Gleichberechtigung beruhende Gesellschaftsordnung existiert hat, die im allgemeinen Matriarchat genannt wird.
Die Menschen sind also von ihrem Wesen her durchaus in der Lage, anders miteinander umzugehen als heutzutage bzw. Menschen waren offensichtlich nicht schon immer „entfremdet“ oder „böse“.
Es wäre auch falsch, zu behaupten, noch nie waren wir besser als heute bzw. wir wären durch steigenden Fortschritt immer „besser“ geworden. Im Gegenteil.
Eine Zunahme der Gewalt ist erst in den letzten Jahrtausenden und besonders in den letzten Jahrhunderten zu verzeichnen. Das untermalt auch eine Zusammenstellung über die Entwicklung der europäischen Kriege seit dem 15. Jahrhundert: Während zwischen 1480–1499 neun Schlachten geführt wurden, waren es im 17. Jahrhundert bereits über 200, im 19. Jahrhundert 650, und in der ersten Hälfte unserer Jahrhunderts fast 900 kriegerische Auseinandersetzungen. Daß dabei auch die Anzahl der Toten und Verletzten explosionsartig gestiegen ist, ist bekannt.
3. Ethnographie
Nicht nur in der Vergangenheit, auch noch in der Gegenwart finden sich Völker oder Stämme, die sich eine Art matriarchale Lebensweise bewahrt haben, bzw. bei denen sich unterschiedlich starke Traditionen dieser Lebensweise immer noch nachweisen lassen. Darüber existiert eine Vielzahl von Büchern.
Lebensbejahendere Kulturen sind also nicht einmal bis heute völlig ausgestorben. Auch in unserer Zeit ist es sogar noch möglich, sich von ihnen anregen zu lassen.
4. Die Auseinandersetzung mit Verbrechern, Mördern, Faschisten
Nehme ich mir beispielsweise die Biografie und die Tagebuchaufzeichnungen von Joseph Goebbels vor, dann stoße ich zu Beginn von dessen Leben nicht etwa auf ein Monster, sondern auf einen schwärmerischen Jungen, der poetisch veranlagt ist, Gedichte, Theaterstücke und Klavierstücke schreibt, der Goethe, Lessing, Cervantes, Wedekind, Hölderlin, Ibsen, Tolstoi liest, der sich verliebt und auf ein Leben voller Liebe und Anerkennung hofft. Und ich kann auch nachvollziehen, wie diese Vorstellungen immer mehr scheitern – woran sein im Alter von vier Jahren entstandener Klumpfuß einen deutlichen Anteil hat, besser gesagt: der Abscheu, den diese Verkrüppelung bei Verwandten, Mitschülern und Mitschülerinnen auslöst. Erst allmählich schiebt sich dann anstelle der unerfüllbaren Liebe zu anderen Menschen die Liebe zum Ersatzobjekt „Vaterland“ in den Vordergrund.
Oder wenn ich zum Beispiel den Spielfilm „Der Totmacher“ mit Götz George als Massenmörder Fritz Hamann nehme oder auch den amerikanischen Spielfilm „Dead man walking“ über einen Sträfling in der Todeszelle: Jedesmal finde ich – neben allem Abstoßenden – immer wieder sehr menschliche, manchmal sympathische oder sogar liebenswerte Züge in diesen angeblichen Bestien. Anders gesagt: Und wenn der liebenswerte und liebenwollende Kern auch noch so verschüttet ist, bei genügend intensiven Kontakt scheint etwas davon durch.
5. Forschungen aus Physik, Biologie, Mathematik, Chemie, Astronomie und Geologie
haben in den letzten Jahrzehnten eine Tendenz nachweisen können, die inzwischen als geradezu entscheidend für sämtliche Lebensvorgänge bezeichnet werden kann: Diese Tendenz wird Selbstorganisation genannt.
Das ist ein Vorgang, der dafür sorgt, daß das, was in einer bestimmten Existenzform an Entwicklungsmöglichkeiten vorhanden ist, auch ausgeschöpft wird. Offenbar hat alles Existierende die Tendenz, sich ohne äußeren Anlaß zu organisieren, sich zu soetwas wie höheren Einheiten zusammenzuschließen, sich weiterzuentwickeln und sich selbst die für diese Weiterentwicklung besten Bedingungen zu schaffen.
Das beginnt schon bei der Erwärmung mancher Flüssigkeiten, die bei einer bestimmten Temperatur plötzlich regelmäßige Muster bilden. Das geht weiter bei der Bildung von Zellen, die sich offenbar „von sich aus“ zu immer komplexeren Strukturen zusammengeschlossen haben. Mikrobiologen sagen heute jedenfalls: Wenn die Natur ausschließlich auf das Tempo der natürlichen Auslese und auf zufällige Mutationen angewiesen gewesen wäre, dann wäre es extrem unwahrscheinlich, daß aus den Bestandteilen des Urozeans bis zum heutigen Tag auch nur eine einzige Zelle entstanden wäre, geschweige denn jene Artenvielfalt, die wir kennen.
Wenden wir das auf die menschliche Rasse an, heißt das zumindest, daß unsere Entwicklungsmöglichkeiten und unsere Entwicklung noch längst nicht am Ende ist. Dafür sprechen nicht zuletzt auch die nach wie vor ungenutzten Teile unseres Gehirns oder scheinbar extreme – manchmal auch paranormal genannte – körperliche und geistige Leistungen einzelner Menschen.
Ich glaube, eine Ahnung von den meist brachliegenden Kräften in uns bekommt auch jeder, der sich gerade frisch verliebt hat.
6. und letztens: die bereits mehrfach angesprochene Selbstregulation
Sie ist für alle Pflanzen, Tiere und ganze Ökosysteme wie Wälder oder Flüsse etwas völlig normales. Jeder dieser Organismen ist ständig damit beschäftigt, die besten Bedingungen für seine Existenz und seine Entwicklung aufrechtzuerhalten bzw. selbst herzustellen, schädliche Einflüsse auszugleichen, nützliche Einflüsse zu verstärken.
Fällt beispielsweise beim Menschen ein Teil des Gehirns aus, springt nach Möglichkeit ein anderer Teil dafür ein und übernimmt dessen Aufgaben. Aber nicht nur zwischen den Teilen des Gehirns – zwischen sämtlichen Organen des menschlichen Körpers bestehen Kooperationsbeziehungen, gegenseitig aufeinander einwirkende Regelkreise. Für die Entgiftung sind z.B. ganz verschiedene Organe im Einsatz: u.a. Leber, Niere, Darm, Haut. Ist eins von ihnen geschädigt, versuchen die anderen, dessen Arbeit wenigstens teilweise mitzuübernehmen. Und sie wirken aus einem einzigen Zweck zusammen: zur Erhaltung des Gesamtorganismus Mensch.
Warum sollte diese „Weisheit des Körpers“ nicht auch im seelischen Bereich ihre Entsprechung finden?
***
Vortrag (gekürzt), gehalten am 7.6.1996 in Erfurt, auf der Tagung der Internationalen Erich-Fromm-Gesellschaft Vom „Gefühlsstau“ zur „Marketing-Orientierung“? Schwierigkeiten und Chancen der deutsch-deutschen Verständigung. Daraus entstand später der Artikel Ich … du … wir … alle … alles. Menschenbilder und Weltbilder als Voraussetzung zum Helfen, veröffentlicht in Ich – Zeitschrift für neue Lebenskultur, Frühling 1997 und noch später der Beitrag
Der Vortrag basiert hochgradig auf Erkenntnissen von Hans-Joachim Maaz, wie er sie u.a. in seinem Buch Der Gefühlsstau – ein Psychogramm der DDR (Argon-Verlag Berlin 1990) zusammengefasst hat, aber auch auf Forschungen von Wilhelm Reich, Erich Fromm und anderen.
Tipps zum Weiterlesen:
Jeder hat den Partner, den er verdient. Hans-Joachim Maaz, befragt von Andreas Peglau