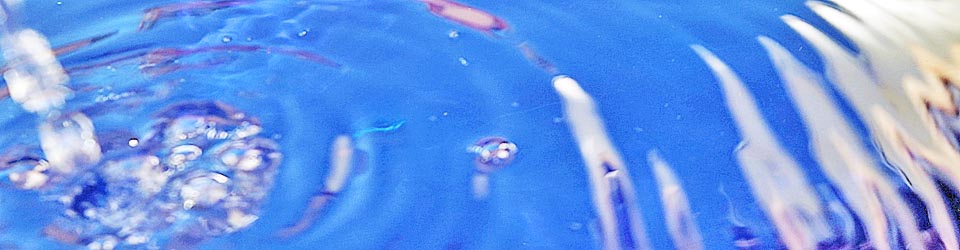von Andreas Peglau
Ein Versuch, mit Hilfe von Erich Fromm, Sudhir Kakar, James Lovelock, Hans-Joachim Maaz, Wilhelm Reich, Rupert Sheldrake und anderen, Psychoanalyse, Ökologie und Gaia-Hypothese zu verbinden.
„So eine Krise wie jetzt hat die Menschheit noch nicht erlebt. Da muss was Vereinigendes am Werk sein, ich spüre es.“
Rudolf Bahro 1995 in einem „Spiegel“–Interview
Zusammenbruch des sozialistischen Staatensystems, wirtschaftliche Öffnung Chinas, Globalisierung, Internet– und Computerboom, Bio– und Gentechnologie, Klimawandel, US–amerikanischer Weltherrschaftswahn – der Jahrtausendwechsel hat Entwicklungen mit sich gebracht, die vor wenigen Jahrzehnten kaum zu erahnen waren. Die alte Frage, wie wir am sinnvollsten leben und handeln können, steht wieder einmal neu.
Ich möchte im Folgenden einige Überlegungen vorstellen, die sich für mich ergeben haben, nachdem ich in meine Suche nach Antworten die Prinzipien der „Verbundenheit“ und der Selbstorganisation einbezogen habe. (Da der Begriff „Selbststeuerung“ einen relativ mechanischen Vorgang nahelegt, bevorzuge ich „Selbstorganisation“ – was unvorhersehbare Anteile einer Entwicklung nicht ausschließt und insofern für Lebensprozesse die angemessenere Beschreibung abgibt1. So verstanden, entspricht meiner Meinung nach „Selbstorganisation“ auch dem von W. Reich verwendeten Begriff „Selbstregulation“.)
Beginnen wir bei der „Verbundenheit“. Ist es überhaupt ein Merkmal des Lebens, verbunden zu sein? Wie intensiv sind die Zusammenhänge zwischen einem einzelnen Menschen und der Welt?
Verbundenheit
Damit wir existieren können, damit unsere wichtigsten Bedürfnisse befriedigt werden, brauchen wir andere Menschen – von unserer Zeugung an. Ein „asozialer“ Fötus ist nicht denkbar. Auch ein Säugling, der nicht über die Nahrungsaufnahme hinaus durch Lautäußerungen, Körper– und Blickkontakt mit seiner Umgebung in Beziehung treten kann, verkümmert oder stirbt.
Je erwachsener wir werden, desto intensiver binden uns Normen, Werte, Geld– und Warenkreislauf, bislang auch die arbeitsteilige Produktion an die Gesellschaft. Traditionen schlagen Brücken zu unseren Vorfahren, das von C. G. Jung beschriebene „kollektive Unbewusste“ vielleicht sogar zu den Anfängen der Menschwerdung.
Darüber hinaus sind wir von Beginn an auch mit unserer nichtmenschlichen Umwelt verbundene, ökologische Wesen. Kaum zur Welt gekommen, beginnen wir, „Pflanzenatem“ in unsere Lungen zu saugen – und uns umgehend mit Kohlendioxid bei unseren grünen Lebensgefährten zu revanchieren. Wir ernähren uns, indem wir Bestandteile anderer Lebewesen zu Teilen unseres eigenen Körpers umbauen. Durch Biophotonen kommunizieren unsere Zellen nicht nur miteinander, sondern auch mit der Außenwelt2. „Morphogenetische Felder“3 scheinen uns mit allen Lebewesen zu verbinden, unsere Gedanken, Gefühle, Ideen zu beeinflussen. Das Lebensenergiefeld unseres Planeten steht – wie W. Reichs Forschungen belegen4 – in ständiger Wechselwirkung mit unserem eigenen, prägt unser Befinden und Verhalten. Die Anziehungskraft des Mondes, die ganze Weltmeere in Bewegung setzt, beeinflusst mit Sicherheit auch unsere, vorwiegend aus Wasser bestehenden Körper. Die Wärme der Sonne durchdringt uns, ihre Strahlen machen unsere Knochen erst fest genug zum Laufen, Sonnenenergie ist die Voraussetzung für das gesamte irdische Leben.
Wir sind also auf das Intensivste mit unserer Umwelt verknüpft. Aber damit nicht genug: Die Übergänge zwischen ihr und uns sind fließend! Ab wann ist denn die Luft in meinen Lungen und in meinem Blutkreislauf, die Nahrung in meinem Magen–Darm–System schon „ich“? Und bis zu welchem Zeitpunkt? Ist derjenige, den ich im Spiegel sehe, nicht eine – teils unauflösbare – Symbiose aus einem Menschen und unzähligen (durchschnittlich 70 Billionen im Darm, 300 Millionen auf der Haut, 100 Millionen im Mund5) Bakterien? Inwieweit sind die Pflanzen in meinem Zimmer, die sich ihre Zellen nicht zuletzt aus meiner Atemluft gebaut haben, ein Teil von mir – und umgekehrt: Inwieweit bin ich, der ich mir fortwährend den von ihnen ausgeschiedenen Sauerstoff einverleibe, ein Teil von ihnen?
Haben sich nicht die Atome, aus denen wir bestehen, im Laufe der letzten Milliarden Jahre in allen möglichen belebten und unbelebten, irdischen und nichtirdischen Daseinsformen herumgetrieben? (Weshalb z.B. mit plausibler mathematischer Grundlage behauptet werden kann: „Jedes Mal, wenn Sie Luft holen, atmen Sie mindestens ein Atom ein, das Albert Einstein – oder Julius Cäsar oder Marilyn Monroe oder meinetwegen auch der letzte Tyrannosaurus Rex, der über den Erdboden stapfte – ausgeatmet hat.“6)
Nehmen wir darüber hinaus die Theorie des „Urknalls“ ernst (laut der ja am Anfang unserer Welt alles mit allem auf engstem Raum verschmolzen war) wie auch die Behauptung der Quantenphysik, dass Teilchen, die irgendwann einmal zusammengehört haben, selbst dann noch aufeinander einwirken, wenn Lichtjahre zwischen ihnen liegen – hieße das dann nicht sogar, dass wir wahrhaft kosmische Wesen sind, verknüpft mit der ganzen Welt seit ihrem Ursprung? Und dementsprechend wohl auch bis zu ihrem Ende, also über den individuellen Tod hinaus?
Einige neuere physikalische Theorien gehen zudem davon aus, dass wir letztlich nicht aus kleinsten Materieteilchen bestehen, sondern dass diese Teilchen selbst nur herumwirbelnde Energie sind und daher alles, was existiert – uns eingeschlossen – ein schwingendes, tanzendes Gewebe ist aus ein und demselben „Stoff“: pure Energie.7
Für manche anderen Kulturen scheinen ähnliche Gedanken selbstverständlicher zu sein. Dazu der indische Psychoanalytiker und Schriftsteller Sudhir Kakar:
„Nach ayurvedischer Vorstellung besteht im Universum alles, ob belebt oder unbelebt, aus fünf Formen der Materie – Erde, Feuer, Wind, Wasser und Äther –, wobei jedes Element grobe und feine Formen aufweist. Unter bestimmten günstigen Bedingungen organisiert sich Materie in Form von Lebewesen. Die Körper der Lebewesen absorbieren beständig die fünf Elemente, die in der Umwelt enthalten sind. Insofern ist es nicht erstaunlich, dass das indische Körperbild den intimen Zusammenhang von Körper und Umwelt betont, wobei ein unaufhörlicher Austausch von Umwelt und Körper einhergeht mit beständigen Veränderungen innerhalb des Körpers.“8
Ob wir die letztgenannten Ansichten teilen oder nicht: Persönliche Probleme waren von denen, die der Rest der Welt hat, noch nie vollends zu trennen. Neu aber ist diese konkrete Ausprägung dieses Zusammenhangs: Eine (wohl weitgehend menschengemachte9) globale ökologische Krise schlägt sich auch in lokalen Umwelt–Katastrophen nieder, die wiederum soziale Einbrüche nach sich ziehen – vor allem in der „Dritten Welt“. Je tiefer jene Völker ins Elend gestoßen werden, desto erpressbarer werden sie, sich zu Minimalkosten als Arbeitskräfte einsetzen zu lassen – und liefern so zusätzliche Vorwände für den Sozialabbau in Westeuropa und anderswo.
Die durch all das noch weiter an Einfluss gewinnenden destruktiven Ideologien – ob „rechts“, „fundamentalistisch“, „terroristisch“ oder sonstwie betitelt – machen erst recht nicht an Ländergrenzen halt. Und ihre fanatisierten Anhänger drehen auch hierzulande mit an der Gewaltspirale: um so erfolgreicher, je mehr Menschen Arbeit und Lebenssinn verlieren.
Mehr als jemals zuvor scheint heute zu gelten: Wir helfen uns selbst, wenn wir positiven Einfluss nehmen auf die Situation anderer Menschen, auf Ökosysteme, auf unseren ganzen Planeten.
Aber wie soll das gehen? Welches soziale, politische und ökologische Handeln wäre am hilfreichsten in dieser verbundenen Welt? Vielleicht kann uns das Prinzip der „Selbstorganisation“ helfen, diese Frage zu beantworten.
Selbstorganisation
Dass Leben keinen Stillstand duldet, ist klar. Dass Lebensvorgänge nicht linear verlaufen, unsere Körpergröße z.B. nicht lebenslang zunimmt, hat sich ebenfalls herumgesprochen. Aber (unser) Leben findet offenbar auch nicht, wie vielfach stattdessen formuliert, in Kreisläufen statt. Lebens„zyklen“ führen niemals exakt zu dem Punkt zurück, von dem sie ihren Anfang nahmen. Der konkrete Wassertropfen, der in den Himmel verdampft, kehrt nie wieder als Regentropfen auf die Erde zurück. Würden wir nach unserem Tod wiedergeboren, könnten wir doch niemals wieder dieselben Menschen werden – nicht nur, weil wir kaum erneut dieselben Erbanlagen haben dürften, sondern auch deswegen, weil die Erde sich inzwischen verändert hätte und daher anders auf uns einwirken würde. „Niemand steigt zweimal in den selben Fluss“ – dieser Satz trifft den gleichen Sachverhalt.
(Vermitteln uns daher nicht Orientierungen auf Kreisläufe, Kreislaufwirtschaften u.ä., eine irreale Beruhigung: „Alles im Lot, wir kehren ja nur immer wieder zu unserem Ursprung zurück“ – oder einen ebenso irrealen Fatalismus: „Es ändert sich eh nie was“?)
Suchen wir nach einer Möglichkeit, Lebensvorgänge graphisch darzustellen, bietet sich deshalb statt des Kreises wohl eher die Spirale an: Ein offenes System, das sich ständig verändert, weiterentwickelt, Neues schafft, an Punkte kommt, wo es nie zuvor war – und trotzdem auf dem davor Gewesenen aufbaut. Aber was treibt diese Spirale an?
Wird Wasser im Experiment kontinuierlich erwärmt, schlägt die zunächst unregelmäßige, chaotische Bewegung der erhitzten Wassermoleküle irgendwann in klare Strukturen um: Die Moleküle schließen sich zu unaufhörlich rotierenden „Walzen“ zusammen. Andere Flüssigkeiten bilden, wenn ihnen Energie zugeführt wird, Wabenstrukturen aus.10 Was hier von außen, also künstlich herbeigeführt wird, läuft in der Natur scheinbar unaufhörlich „von allein“ ab.
Lebendige Systeme scheinen in sich nicht nur eine Tendenz zum letztendlichen Zerfall, zum Tod zu haben, sondern gleichzeitig eine Tendenz zu anwachsender Komplexität, zur „Selbstorganisation“.
Nehmen wir uns Menschen. Mit Beginn unserer Existenz verfügen wir nicht nur über bestimmte Grundausstattungen, sondern auch über interne „Entwicklungsprogramme“ für die volle Entfaltung dieser Anlagen. Unsere sämtlichen Organe funktionieren und kooperieren genau zu diesem Zweck. (W. Reich 1949: „Der Organismus als Ganzes bildet ein natürliches Kooperativ gleichwertiger Organe verschiedener Funktion.“11) Leber, Niere, Haut beispielsweise sorgen einerseits für ihren eigenen Erhalt – und gleichzeitig gemeinsam für unsere Entgiftung. Ist eins von ihnen vorübergehend geschwächt, arbeiten die anderen um so härter an dieser Aufgabe.
Oder werfen wir einen Blick auf das Organ, über das in letzter Zeit unter dem Stichwort „Neuroplastizität“12 höchst erfreuliche Neuigkeiten zu erfahren sind: das menschliche Gehirn. Hieß es noch vor wenigen Jahren, nach der Pubertät fände oberhalb des Halses nur noch Schrumpfung statt, scheint jetzt erwiesen zu sein: Unser Gehirn nutzt beständig rationalen und emotionalen „Input“, um sich – wenn möglich – lebenslang zu vervollkommnen. Und es versucht, durch „Neuverschaltung“ und Kooperation mit anderen Körperregionen selbst gravierende Schädigungen teilweise oder komplett auszugleichen. Nachdem zum Beispiel blinde Menschen gelernt haben, Blindenschrift zu lesen, „reagieren die Nervenzellen der ursprünglichen primären Sehrinde sehr empfindlich auf die Signale der Mechanosensoren in der Haut“13 – durch Verlust des Augenlichts „freigewordene“ Hirn–Kapazität wird eingesetzt, um die Wahrnehmungsfähigkeit für taktile Schrift–Reize zu erhöhen. (Und in Tierversuchen wurde sogar nachgewiesen, dass Frettchen mit durchtrenntem Sehnerv lernen, mit Hilfe des Hörzentrums zu sehen.14)
Wir haben also offenkundig eine Art „Trieb zur Weiterentwicklung“ in uns – und damit auch einen inneren Maßstab dafür, was gut für uns ist: alles, was dieser Vervollkommnung dient. Wir fühlen von Anfang an, was wir brauchen – körperlich, seelisch, sozial, ökologisch. Da wir diesen Kompass haben, sind wir auch in der Lage, Umwege zu gehen, Kompromisse zu machen.
Organisieren sich Ökosysteme selbst?
Lässt sich das, was da im einzelnen Individuum abläuft, auch auf Gruppen von Lebewesen übertragen? Das wäre doch gut, denn dann könnten wir sagen: Ebenso, wie jeder und jede einzelne von uns eine Art internen Wegweiser hat, besitzt ihn auch jedes Kollektiv, jede Gesellschaft, jedes Ökosystem.
Beginnen wir bei den Ökosystemen. Steigt zum Beispiel durch veränderte Umweltbedingungen in einem Waldgebiet die Zahl der sterbenden Bäume, wächst in der Regel auch die Zahl derjenigen Insekten, die den abgestorbenen Baumbestand verwerten (dafür oft als „Schädlinge“ bekämpft werden) und damit Platz für neue Pflanzen schaffen. Ist ihre Aufgabe erfüllt, werden sie in der Regel wieder weniger – wegen des sich wieder verringernden Nahrungsangebots und der Vermehrung ihrer natürlichen Feinde. Der Wald ist wieder „im Gleichgewicht“ – aber in einem anderen als zuvor. Vielleicht können nun sogar Bäume wachsen, die mit den veränderten Umweltbedingungen besser klarkommen.
Haben hier auch Entwicklungsprozesse stattgefunden? Eindeutig: Ja. Hat nicht auch hier Kooperation das Problem gelöst? Nur, wenn wir Fressen und Gefressen-Werden als Zusammenarbeit gelten lassen. Schon das wäre allerdings ein deutlicher Unterschied zum friedlichen Zusammenwirken unserer inneren Organe.
Aber es gibt eine noch wesentlichere Frage: Halten wir die beschriebene Veränderung tatsächlich für „von langer Hand geplant“? Wollen wir wirklich annehmen, dass es auch für Ökosysteme ein „internes Entwicklungsprogramm“ gibt, auf dem in groben Zügen vermerkt ist, in welche Richtung sich dieser Wald im Idealfall verändern sollte – so, wie offenbar bei jedem Individuum?
Ich halte das nicht für glaubhaft. Daher kann ich in einem Ökosystem auch keine „Selbstorganisation“ erkennen: Der Antrieb für die beschriebene Veränderung des Waldgebietes kam von außen, das Ökosystem hat nur reagiert. Der Impuls zur Neuorganisation wurde hineingetragen. Dass sich auch hier eine „Spiralbewegung“ ergeben hat, lag nicht an einer absichtsvollen Eigendynamik des Waldes, sondern an seinem Eingebunden-Sein in weitere Zusammenhänge.
Anders formuliert: Jeder der beteiligten Bäume hat zwar ein lebendiges „Selbst“, das zur Organisation fähig ist – der Wald als Ganzes hat aber ebenso wenig ein „Wald–Selbst“, wie durch das Zusammenleben von 20 Menschen in einem Haus eine „Kollektiv–Seele“ entsteht oder durch das Zusammenleben in Nationalstaaten eine „Volksseele“. Nur dort, wo ein „Selbst“ vorhanden ist, kann Selbstorganisation stattfinden.
Natürlich kann es innerhalb einer Gruppe von Menschen zu hochdramatischen Handlungen kommen, nach denen „nichts mehr so ist, wie es war“, natürlich können nach einem verbindenden gemeinsamen Erlebnis viele Einzelne „vervollkommneter“ sein. Eine vorgegebene Entwicklungsrichtung für irgendeine konkrete menschliche Gemeinschaft oder gar Gesellschaft kann ich aber nicht annehmen. Aber bei der Selbstorganisation (jedenfalls so, wie ich sie verstanden habe15), geht es eben gerade nicht um beliebige Eigendynamiken (irgendetwas schaukelt sich zu irgendetwas anderem auf), sondern um in einer bestimmten Richtung ablaufende Veränderungen.
Nun hat aber der Wald, von dem die Rede war, vielleicht tatsächlich eine positiv interpretierbare Weiterentwicklung erfahren. Etwas hat dafür gesorgt, dass er sich in einer Weise verändert, angepasst hat, die sein Weiterleben im Ganzen möglich macht. „Der Wald“ selbst war es nicht – wer dann? Die einzelnen an der Umgestaltung beteiligten pflanzlichen und tierischen Individuen?
Absterbende Bäume können durch Geruchsstoffe Insekten anziehen, diese wiederum ihre natürlichen Feinde beispielsweise durch die Farbe ihrer Flügel auf sich aufmerksam machen. Aber das für „Absicht“ zu halten, würde voraussetzen, dass all diesen Organismen ihre persönliche Existenz unwichtiger ist als die des „großen Ganzen“ – des Waldes. Tiere und Pflanzen kämpfen doch aber mit allen Mitteln um ihr Überleben! In Ausnahmefällen opfern sich zwar Elterntiere für den eigenen Nachwuchs – aber für den Erhalt eines Ökosystems?? Kein mir bekannter Fakt spricht dafür.
(Außerdem: Sind nicht „Ökosysteme“ tatsächlich vorwiegend „reine Abstraktion“, mehr oder weniger willkürliche vollzogene Abgrenzungen, die Erfassbarkeit und Berechenbarkeit der Natur – deren Stoffumsätze u.ä. – vereinfachen sollen16?)
Wer steckt hinter der Entfaltung des irdischen Lebens? Die „Gaia-Hypothese“
Aber betrachten wir eine noch viel grundlegendere ökologische Veränderung als die soeben beschriebene.
Vor etwa 4 Milliarden Jahren, im Erdzeitalter Hadäum, gab es zwar auch schon Wasser, die zukünftige Basis des Lebens. Aber dieses Wasser wurde durch chemische Reaktionen ständig zu gasförmigem Wasserstoff umgewandelt – der in den Weltraum entwich. Wäre das so weitergegangen, „wäre die Erde nach 2 Milliarden Jahren ausgetrocknet und böte jetzt das Bild eines toten Planeten wie Mars oder Venus“17. Und nichts von dem, was wir heute „Naturgesetze“ nennen, hätte dem entgegengestanden. Im Gegenteil: Die physikalischen und chemischen Vorgänge, die zur Austrocknung geführt hätten, verliefen völlig „gesetzmäßig“; die Erde hätte sich eigentlich auf einen toten Gleichgewichtszustand einpegeln müssen.
Aber dann passierte etwas Erstaunliches: Bakterien entstanden und begannen, Wasserstoff in ihre Stoffwechselvorgänge einzubeziehen – und so auf der Erde zurückzuhalten. Ein Prozess, der über eine Milliarde von Jahren anhielt und letztlich dafür sorgte, dass die Voraussetzungen für die Entfaltung des Lebens erhalten blieben und sich immer günstiger gestalteten.
Und damit nicht genug: Anschließend beschäftigten sich dieselben Bakterien zwei Milliarden Jahre lang damit, sich selbst wieder von der soeben eroberten Erdoberfläche zu vertreiben, indem sich einige von ihnen zunehmend auf die Produktion von Sauerstoff umstellten. Das war zwar pures Gift für die meisten dieser Mikroorganismen – aber neben Wasser die zweite notwendige Bedingung für die Entstehung des Lebens, wie wir es heute kennen.
Alles Zufälle? Das halte ich für ausgeschlossen.
Doch wenn nicht, wer könnte dann solche umfassenden Veränderungen „initiiert“ haben, wer könnte auch die Folgen der gigantischen Meteoriteneinschläge und anderer Katastrophen ausgeglichen haben, die immer wieder prägend waren für die Geschichte unseres Planeten? Wer ist in der Lage, seit vier Milliarden Jahren geologische, klimatische, biologische Prozesse, Entwicklungen in derart verschiedenen und ausgedehnten Ökosystemen wie Flüssen, Ozeanen, Regenwäldern so zu koordinieren, dass sich Leben nicht nur erhalten, sondern höherentwickelt hat? Wer hat den notwendigen „Überblick“, ist gleichzeitig mit allen dazugehörigen Lebensvorgängen verbunden? Wer hätte ein Interesse daran, verschiedene Individuen oder Gemeinschaften von Tieren und Pflanzen für Zusammenhänge zu „instrumentieren“, notfalls auch zu opfern, die weit über diese Tiere und Pflanzen hinausgehen? Wer könnte solche Prioritäten setzen: Im Zweifelsfall zugunsten der größeren Gesamtheit?
Zum Beispiel diese Gesamtheit selbst. „Gaia“ nennt sie der Biologe und Geowissenschaftler James Lovelock18: Ein sich entwickelndes System, „bestehend aus allem Lebendigen und seiner Oberflächenumwelt, den Meeren, der Atmosphäre, dem Krustengestein“, das, „wie jeder biologische Organismus seinen Stoffwechsel und seine Temperatur selbst regelt, … Klima und chemische Zusammensetzung völlig selbsttätig“ reguliert.
Lovelock betont zwar, dass „Gaia“ keine Person sei, keine „vorausschauende und ein bestimmtes Ziel anstrebende Göttin“, aber er vergleicht sie immerhin mit einem Baum. (Ich denke allerdings: Nur ein Wesen, dessen Fähigkeiten unseren menschlichen unvorstellbar überlegen sind, könnte die genannten kreativen Leistungen vollbringen.) Doch selbst ein Baum hat ja jenes interne Entwicklungsprogramm, jenen inneren Kompass, jenen Drang zur Vervollkommnung – zur Selbstorganisation.
Aber erfüllt „Gaia“ die Kriterien, welche – zusätzlich zu selbstregulierten Stoff– und Energie“kreis“läufen – zumeist19 als unverzichtbar für Lebewesen angesehen werden: klare Abgrenzung nach Außen, zentrale Steuerinstanz, Fortpflanzung?
Die geforderte Abgrenzung ist eindeutig vorhanden, die Erde ist als Individuum erkennbar.
Was die zentrale Steuerungsinstanz betrifft: Auch bei anderen Lebensformen ist strittig, dass diese Steuerung von einem ganz bestimmten Punkt, einer Zentrale, ausgeht. Wo sitzt sie in den Pflanzen? Auch in Gehirnen wurden statt einer einzigen „Kommandostelle“ hochkomplexe, sich permanent umgestaltende Vernetzungen aufgefunden20; manche Wissenschaftler machen dem Hirn ohnehin die alleinige Führungsrolle zugunsten einer „Körperintelligenz“ streitig.21 Könnte also nicht etwas Ähnliches für „Gaia“ zutreffen: Dezentrale Koordination – vielleicht mittels der von Rupert Sheldrake aufgespürten „morphogenetischen Felder“?
Und was die Fortpflanzung betrifft, die ja auch bei den verschiedenen bislang bekannten Lebewesen auf ganz unterschiedliche Weise vonstatten geht: Ich denke, die sich abzeichnende Möglichkeit, das irdische Leben auf andere Planeten übersiedeln zu lassen, könnte diesen Tatbestand in ausreichendem Maß erfüllen. (Für Erich Jantsch ist – nachzulesen in seinem Buch „Die Selbstorganisation des Universums“22 – die Besiedlung des Kosmos eine von zwei überhaupt nur möglichen Weiterführungen der irdischen Evolution und Selbstorganisation.)
Kurzum: Es spricht einiges dafür, auch „Gaia“ als ein sich selbst organisierendes Wesen zu betrachten – wie jede Pflanze, jedes Tier und jeden Menschen.
Störungen der Selbstorganisation
Doch das Bild, welches die menschliche Zivilisation zur Zeit bietet, legt den Schluss nahe, dass wir Menschen den Kontakt zum „Prinzip Selbstorganisation“ in mancher Hinsicht verloren haben. Wodurch könnte das geschehen sein? Diese Frage führt uns wieder zum Thema „Verbundenheit“ zurück: Auch wenn jede(r) Einzelne von uns gesunde Maßstäbe in sich trägt, kann er oder sie diese Maßstäbe doch nicht für sich allein verwirklichen.
In der Realität sind aber viele unserer „Beziehungen zur Welt“ in einem Maße gestört, dass diese Störung kaum noch als Anreiz für eine positive Entwicklung verwertet werden kann. Insbesondere in der sensiblen Anfangsphase unseres Lebens drohen uns bleibende Schädigungen durch Gift in Atemluft und Nahrung, Ozonloch, Elektrosmog oder atomare Strahlungsaustritte, durch lebensfeindliche Erziehungs–Normen, durch aufgestaute destruktive Gefühle unserer Kontaktpersonen. Die für eine funktionierende menschliche Selbstorganisation notwendige Kommunikation und Kooperation mit unserer Umwelt kommt vielfach nur unzureichend zustande.
Wir können daher unsere Anlagen und Talente nur sehr eingeschränkt entwickeln, setzen unsere Kreativität weniger dafür ein, in uns und außerhalb von uns etwas Neues, Einmaliges zu schaffen – sondern vor allem dazu, uns den einengenden Verhältnissen erfolgreich anzupassen.
Anders formuliert: Wir verlieren den Kontakt zu unseren gesunden inneren Maßstäben (unserem, so Reich, „biologischen Kern“), orientieren uns auf neurotische Ersatzziele. Unsere Selbstorganisationsfähigkeit nimmt Schaden und wird ins Unbewusste verdrängt. Und mit jeder neuen, Verbundenheit und Selbstorganisation einschränkenden Situation, auf die wir nicht angemessen reagieren können oder dürfen, staut sich in uns Wut, Hass und Verzweiflung.
Nehmen wir also an, Verbundenheit und Selbstorganisation sind wesentlich für unser Leben, Lebewesen hätten, bewusst oder unbewusst, Kenntnis vom „rechten Weg“ und die Fähigkeit, diesen Weg zu gehen. (Vielleicht ist Liebe das Gefühl, das in uns entsteht, wenn Verbundenheit und Selbstorganisation gleichermaßen funktionieren?)
Machen wir uns von diesen Annahmen ausgehend an den Versuch, die Anfangsfrage nach sinnvollem, hilfreichem Handeln in der Welt zu beantworten.
Soziales Handeln
Welche zwischenmenschliche Hilfe ist am sinnvollsten? Offenbar jene Einwirkung auf andere, bei der sich die Helfenden mit der (vielleicht verschütteten) Selbstorganisationsfähigkeit der Hilfsbedürftigen verbünden, mit deren Bestreben, nach eigenen gesunden Maßstäben zu leben: Hilfe zur Selbsthilfe.
Das setzt voraus, dass sich die Helfenden von der Idee verabschieden, sie könnten andere auf Dauer gegen deren Willen heilen oder retten. (Sicher kann ich einen potentiellen Selbstmörder einmal rechtzeitig aus dem Wasser ziehen. Wenn er anschließend die Probleme, die ihn zum Selbstmord getrieben haben, nicht lösen kann, wird er jedoch wahrscheinlich seinen Versuch irgendwann erfolgreich wiederholen.)
Damit verknüpft ist, sich von der Illusion zu trennen, als Helfende grundsätzlich über den anscheinend Hilflosen zu stehen, nur weil letztere sich zeitweilig und auch nur in Bezug auf ein bestimmtes Problem in einer instabileren Position befinden als diejenigen, die ihnen helfen.
Der Verzicht auf diese Illusion dürfte durch die Erkenntnis unserer gegenseitigen Verbundenheit erleichtert werden: Auch die Helfenden sind Teil der Gesellschaft, die diejenigen mitgeformt hat, die heute als „Problemfall“ vor ihnen stehen, sind Teil der Umwelt, die jene unglücklich, krank oder destruktiv gemacht hat. Die Hilfesuchenden wiederum sind Symptomträger einer Störung, der zumeist auch die Helfenden ausgesetzt sind – Mangel an gesellschaftlicher Solidarität zum Beispiel. Wer heute hilft, kann daher schon morgen dringend Hilfe benötigen. (Oder benötigt sie ohnehin schon, um effektiv zu helfen – z. B. in Form von Supervision.)
Eine angebotene Hilfe wird deshalb auch um so sinnvoller sein, je mehr sich die Helfenden ihrer Mitverantwortung, ihrer eigenen Gestörtheit bewusst geworden sind (und wenigstens angefangen haben, daran zu „arbeiten“). Nur wenn sie zum Beispiel selbst bereits in Kontakt zu ihren eigenen aufgestauten Gefühlen gekommen sind, werden sie auch die – jeder ernsthaften zwischenmenschlichen Annäherung in unserer Kultur unvermeidlich folgende – Konfrontation mit den aufgestauten Gefühlen der Anderen ertragen.
Eine Hilfe, bei der die Selbstorganisationsfähigkeit der Hilfsbedürftigen wieder erstarkt ist, müsste sich aber auch daran erkennen lassen, dass der erwünschte positive Effekt über die Dauer der Einflussnahme hinaus anhält.
Darüberhinaus sollte es eine gegenseitige Hilfe gewesen sein. So vielschichtig, wie wir miteinander verwoben sind, sollte im Falle einer erfolgreichen Hilfe irgendein positiver Effekt auf die Helfenden zurückwirken, im Idealfall ihr Leben oder Lebensgefühl bereichern. Aber auch, wenn sie keine direkte Rückwirkung erfahren: Jeder gesundende Mensch macht unsere (Um)Welt ein bisschen besser. (Auch dazu noch einmal – im Kulturvergleich – Sudhir Kakar: „Die modernen, westlichen Wissenschaften vom Menschen konzipieren den Menschen als ein individuelles, unteilbares Wesen, das sich selbst gleich bleibt, geschlossen ist und eine innerlich homogene Struktur hat. Dagegen vertreten indische Theoretiker die Meinung, dass der Mensch ein Dividuum, d.h. teilbar ist, … offen, mehr oder weniger flüssig und nur zeitweilig integriert; es ist keine Monade, sondern – mindestens – eine Dyade, die ihr persönliches Wesen aus zwischenmenschlichen Beziehungen ableitet. Diese stärkere Einbeziehung des Menschen in die Gemeinschaft beschränkt sich nicht auf das traditionelle, ländliche Indien. Auch für städtische und hochausgebildete Menschen, die den Großteil der psychotherapeutischen Patienten ausmachen, ist die Orientierung an Beziehungen noch immer die ,natürlichere´ Betrachtung von Selbst und Welt. Mit anderen Worten, für diese Menschen sind persönliche Affekte, Bedürfnisse und Motive relational und entsprechend sind ihre Leiden Störungen von Beziehungen.“23)
Aber zweifelsohne: Die Möglichkeit, anderen Menschen zu helfen oder selbst Hilfe zu bekommen, hängt auch ab von den gesellschaftlichen Umständen, unter denen wir leben. In totalitären, fundamentalistischen Systemen (egal, welche Religion sie als Alibi missbrauchen) oder gar unter Kriegsrecht kann sich Selbstorganisation nicht entfalten. Effektiv helfen zu wollen, schließt die Notwendigkeit politischen, gesellschaftlichen Engagements mit ein – ein Zusammenhang, der meiner Meinung nach gerade für Menschen, die sich auf Wilhelm Reich berufen, selbstverständlich sein sollte.
Aber wofür soll ich mich engagieren, nach welchen Zielen könnte ich in Programmen von Bürgerbewegungen, Vereinen (oder gar Parteien) suchen, welche Ziele könnte ich dort selbst einbringen, wenn ich Verbundenheit und Selbstorganisation fördern will?
Politisches Handeln
Was politische Verbundenheit betrifft, so halte ich nach wie vor Wilhelm Reichs „Massenpsychologie des Faschismus“ für einen der wichtigsten Beiträge zum Thema. Dass ein Großteil von dessen Thesen über die gegenseitige Abhängigkeit von Führern und Geführten24 auch für demokratischere Staatsgebilde zutrifft, scheint mir erwiesen. Mögen die obersten Leiter noch so psychisch gestört sein – sie sind auch immer ein (Zerr)Spiegelbild der Geleiteten. Oder, wie Hans–Joachim Maaz es ausdrückt25: In den Führern zeigt sich die gesellschaftliche Pathologie am deutlichsten.
Und das gilt in einer „globalisierten“ Welt auch über Landesgrenzen hinweg. Hatten wir Deutschen 1990 vor allem Veranlassung, Variationen unserer Charakterdeformation in Honecker und Kohl wiederzuerkennen, müssen wir uns heute auch mit der Frage auseinandersetzen, ob wir nicht G. W. Bush und Osama Bin Laden unsere kaputten Persönlichkeitsanteile ausagieren lassen. Es spricht einiges dafür, dass die Auseinandersetzung zwischen „guten“ westlichen Demokratien und „bösen“ Terroristen ähnliche Funktionen erfüllt, wie einst der „kalte Krieg“: Machterhalt, wechselseitige Projektion destruktiver Energien und Vorwand für deren Ausleben, Ablenkung von wirklich notwendigen – nicht zuletzt „innerpsychischen“ – Veränderungen.
Feindbild-Ideologien – egal, ob da die Andersdenkenden, Andersglaubenden, der „politische Gegner“ oder die jeweiligen Machthaber zum alleinigen Sündenbock erklärt werden – bilden die tatsächlichen Verhältnisse also nicht ab. Wollen wir als Ausgangspunkt politischen Handelns eine realitätsnahe Beschreibung sozialer Gegebenheiten, muss sich in dieser auch unsere eigene Mitbeteiligung und Mitverantwortung wiederfinden. (Bei materiellen Zusammenhängen ist das leichter zu erkennen: Unsere Steuergelder sind Basis für absolut jede Handlung der uns gerade Regierenden. Wer „grün“ wählt, fördert daher trotzdem Atomkraftwerke, wer pazifistisch gesinnt ist, stattet die Bundeswehr mit neuen Waffen aus, Bürgerrechtler finanzieren den Geheimdienst usw.)
Welche politischen Maßnahmen oder Ziele unterstützen nun die Selbstorganisation? Sofort weg mit jeder gängelnden Hierarchie, „Keine Macht für niemand“?
Wenn es stimmt – wie oben behauptet –, dass in Gruppen von Menschen keine automatische „kollektive“ Selbstorganisation und Höherentwicklung stattfindet, dann ist ein bloßer Verzicht auf vormalige autoritäre Reglementierung nicht ausreichend. Denn Wegfall von Unterdrückung provoziert ja auch das Hervorbrechen der durch diese Unterdrückung zerstörerisch gewordenen Impulse. Und: Menschen, die – wie die allermeisten von uns – erst einmal destruktiv gemacht wurden, tendieren dazu, ihren inneren Störungen entsprechende äußere Verhältnisse wiederherzustellen, ungewohnte Freiheit durch altbekannte, „geborgenheitsstiftende“ Unfreiheit zu ersetzen.
Was negativen gesellschaftlichen Entwicklungen entgegengestellt werden kann, ist daher kein „freies Spiel der Kräfte“, auch keine „deregulierte“ Wirtschaft mit ihrem omnipotenten „Markt“, der schon alles richten wird. Sondern das systematische Herstellen besserer Bedingungen für die Selbstorganisation in jedem und jeder Einzelnen – von der schon von Reich26 vehement geforderten natürlicheren Geburt über die nichtrepressive Erziehung bis hin zu entsprechenden politischen Reformen. (Das detaillierteste „Programm“, das mir dazu bekannt ist, hat Hans–Joachim Maaz unter der Überschrift „Therapeutische Kultur“ verfasst27: Ein Bündel von Vorschlägen, wie erwachsene Menschen ihre psychosozialen Deformationen erkennen und „ausheilen“ – und künftige Generationen vor solcherart Deformation bewahren könnten. Obwohl mein eigener Versuch, diese Ideen in links–ökologische Kreise „einzuspeisen“, kläglich gescheitert ist, glaube ich noch immer, dass hier eine gute Plattform für gemeinsames Handeln vorliegt.)
Starre Hierarchien, die Selbstorganisation behindern und kollektiven Hass aufstauen, sollten zwar abgebaut werden bzw. deren Aufbau – schon gar in Form von Weltherrschaftsplänen – im Ansatz vereitelt werden. Die Unterdrückung von Völkern sollte aufgegeben werden – aber weder durch Ersetzen alter Diktatoren durch „moderne“ Fremdherrscher (wie im Irak) noch durch Umschalten auf „soziale Deregulation“. Welcher Hass–Ausbruch in Form von Bürgerkriegen und Massakern einem plötzlichen Machtvakuum folgen kann, war (z.B. in Jugoslawien) und ist weltweit immer wieder zu verfolgen. Stattdessen sollten Unterdrücker einen Teil ihrer Schuld abtragen, indem sie ihre Macht nutzen, um günstigere Bedingungen zu schaffen für individuelle Selbstorganisation – bevor sie sich endgültig aus ihren Machtpositionen zurückziehen.
Blanke Utopie? Hat nicht der politische Führer eines der größten Länder der Welt, Michail Gorbatschow, erst vor zwei Jahrzehnten etwas versucht, das in Teilen auch so gewertet werden kann? Und, wie gesagt: Vergessen wir nicht unsere Mitverantwortung – also auch unsere Mitgestaltungsmöglichkeiten in Bezug auf das, was „die da oben“ treiben. Wir sind – im Negativen und Positiven – weit mehr als „kleine Rädchen“.
Aber wenn wir die ökologische Krise nicht einigermaßen in den Griff bekommen, brauchen wir uns keine Hoffnungen auf positive politische Veränderungen zu machen. Auf dauerhaft überschwemmtem oder ausgetrocknetem Land, unter krebserzeugenden Ozonlöchern und in vergifteter Luft gedeiht kein friedliches Utopia. Wie könnten wir also unsere bisherigen Überlegungen auf das Thema Ökologie anwenden?
Ökologisches Handeln
Auch in „Gaia“ staut sich seit Jahrhunderten etliches an. Ständig werden natürliche Fließprozesse von Wasser, Luft und Lebensenergie, werden Stoffwechselvorgänge zwischen den globalen Ökosystemen durch uns Menschen manipuliert oder blockiert. Auch hier scheint zu gelten: Je länger und rigoroser wir diese Prozesse unterdrücken, um so furchtbarer werden die Rückschläge sein.
Bzw.: Sie sind es schon. Während in Europa – und sogar auch in Kalifornien – allmählich die Erkenntnis dämmert, dass der Klimawandel eine Realität ist, die möglicherweise nicht erst unsere Enkel betrifft, sterben schon längst immer mehr Menschen in Bangladesh und anderswo an dessen Folgen.
Wenn aber auch „Gaia“ ein lebender, sich selbst organisierender Organismus ist, haben wir Menschen weder die Chance, noch die Verantwortung, sie zu „heilen“ oder gar: sie zu retten. (Auch nicht mit Reichs wettermachendem „Cloudbuster“). Das kann sie nur selber tun, mit ihren eigenen Selbstheilungskräften. Wir können versuchen, diese Kräfte zu erkennen und möglichst gute Bedingungen dafür zu schaffen, dass sie sie einsetzen kann, ohne gigantische Zerstörungen hervorrufen zu müssen. Wir können beispielsweise „begradigten“ Flüssen wieder einen natürlicheren, geschwungeneren Verlauf ermöglichen und damit die Gefahr von Überschwemmungskatastrophen verringern. Und wir können vielleicht, nach gründlichstem Studium der gegenwärtigen „Lebensphase“ und „Interessenlage“ von „Gaia“, dieselbe ganz vorsichtig dabei unterstützen, ihre Blockaden auf möglichst sanfte Weise zu lösen – offensichtlich auch mit einem „Cloudbuster“.28 Und natürlich können wir versuchen, all das umzusetzen, was u.a. der – leider nicht US–Präsident gewordene – Al Gore an umweltschützenden, Negativ–Trends abbremsenden Maßnahmen zusammengetragen hat: siehe www.globalmarshallplan.org.29
Wir können „Gaia“ also vielleicht helfen.
Aber ist das nicht völlig daneben: Wir – als Helfer der Erde? Sind die Menschen nicht das größte Problem, das die Erde hat? Hätten wir nicht – sollten wir überhaupt in der Lage sein, uns zu bessern – genug damit zu tun, das Bestehende einfach nur zu bewahren?
Gegenfragen:
Sind wir nicht – siehe „Verbundenheit“ – selbst ein Teil von „Gaia“? Ist die Menschheit nicht als Element eines – damals vermutlich noch ziemlich intakten – sich selbst organisierenden globalen Lebenssystems entstanden? Heißt das nicht zugleich: Wir waren kein „Irrläufer der Evolution“, sondern eine Bereicherung? Und sind wir das nicht vermutlich immer noch, weil wir ansonsten schon längst als reiner Störfaktor „natürlich ausgelesen“ worden wären?
Haben wir nicht – als eine Gattung, deren globale Verbundenheit bis 1945 höchstens durch Welt–Kriege nachfühlbar wurde – in erstaunlich kurzer Zeit auf die ökologische Herausforderung reagiert, trotz und inmitten aller unserer sonstigen Zwistigkeiten? Ist es nicht – selbst wenn dieses Tempo sich letztlich als zu langsam herausstellen sollte – eine großartige menschliche Leistung, dass innerhalb von nur 40 Jahren ein derartiges weltweites Bewusstsein für ökologische Verbundenheit entstanden ist – inklusive einer Vielzahl daraus abgeleiteter praktischer Konsequenzen?
Was bedeutet es, wenn ein Viertel der tierischen „Biomasse“ unseres Planeten vom Menschen und vor allem von den von ihm gezüchteten Tieren auf die Waage gebracht wird30: nur, dass wir Tiere schamlos für unsere Interessen ausbeuten – oder nicht auch, dass wir auf diesem Planeten längst in enormen Maß lebensschöpfend tätig sind? Das Dasein von Schlachtrindern und -schweinen, von Legehennen und Stadtwohnungshunden lebenswerter zu gestalten, ist mit Sicherheit nötig. Aber sollten wir uns nicht zudem klarmachen, dass es diese Tierrassen und die Billionen ihrer Vertreter (allein im Jahr 1999 waren es 20 Milliarden, drei Billionen Honigbienen nicht mitgerechnet31) ohne uns nie gegeben hätte? Sollten wir uns, selbst dort, wo eine naturnahe Tierhaltung praktiziert wird, lieber wünschen, diese Lebewesen hätten nie existiert?
Wie ließe sich eine ausschließliche Lebensfeindlichkeit unserer Zivilisation damit in Einklang bringen, dass „zwei Drittel aller überhaupt in Mitteleuropa vorkommenden Arten auch – und viele davon in beträchtlichen Beständen – in Großstädten leben“, dass „Berlin in seinem Stadtgebiet einen Artenreichtum bei allen daraufhin untersuchten Gruppen von Tieren und Pflanzen aufweist, der in die Qualitätsklasse hervorragender Naturschutzgebiete fällt“32? Ist nicht überhaupt ein großer Teil dessen, was wir als „unbedingt erhaltenswerte Natur“ betrachten – mitteleuropäische Wälder und Feldfluren, ganze Küstenstriche der Nordsee zum Beispiel – längst auch ganz wesentlich mitgeformt oder sogar geschaffen durch uns Menschen33?
Wäre nicht jeder Versuch des reinen Bewahrens angesichts eines sich selbst organisierenden – und das heißt, sich „gesetzmäßig“ ständig verändernden, weiterentwickelnden – „Organismus Erde“ zum Scheitern verurteilt und sinnvollerweise zu ersetzen durch zunehmende Erkenntnis der Art und Richtung dieser Veränderung und unserer vermutlich nicht–zufälligen Rolle dabei? Welchen vergangenen Zustand der Natur würden wir andernfalls als anstrebenswert, als „natürlich“ ansehen wollen: den vor der industriellen Revolution? Vor dem Patriarchat? Vor der Menschwerdung? Die Zeit, als die Erde vorwiegend von Bakterien bewohnt war? Den „Urknall“?
Hat die geo-bio-psycho–soziale Einheit Erde als Ganzes außer einer menschengemachten Belastung nicht auch eine menschengemachte Aufwertung erfahren durch den Bau Venedigs, durch Bachs Brandenburgische Konzerte, Goethes „Faust“, Van Goghs „Sternennacht“, Sigmund Freuds „Traumdeutung“, John Lennons „Imagine“? Durch jedes Liebespaar, durch jedes Kind, das seine Welt staunend erkundet?
Und sind nicht auch in Zukunft Beiträge zur Entwicklung unseres Planeten vorstellbar, die nur von dessen menschlichen Bewohnern geleistet werden können? Vielleicht die Kommunikation mit außerirdischen Zivilisationen. Vielleicht das Ansiedeln irdischen Lebens und irdischer Kultur auf anderen Planeten. (Spätestens wenn uns das gelingen sollte, hätten wir in „Gaias“ Lebenslauf eine entscheidend positive Rolle gespielt: als diejenigen, die ihre „Fortpflanzung“ ermöglichten.)
Vielleicht aber auch, eine Abwehrmöglichkeit zu entwickeln für den nächsten großen Meteoriteneinschlag, der „Gaia“, alle Tiere, Pflanzen und uns vernichten könnte. Vielleicht … Doch halt: Soll das heißen, wir könnten die Erde doch retten?
Zum einen: auch hier wieder nicht auf Dauer oder entgegen den größeren Zusammenhängen, in die sie als Himmelskörper einbezogen ist. Einem vereinzelten Meteor könnten wir möglicherweise etwas entgegensetzen, eine Ausnahmesituation „ausbügeln“ – einer kosmischen Konstellation, die uns dauerhaft in ganze Meteoritenschwärme hineinzieht, dürften wir kaum standhalten. Zum anderen: Könnte nicht auch eine solche Hilfsaktion als Ausdruck von „Gaias“ Selbstheilungskräften angesehen werden?
Gesellschaftlicher Fortschritt auf Initiative von „Gaia“?
Wenn „Gaia“ eine eigenständige Existenzform wäre, dürfte diese Existenzform – wie andere auch – an ihrem Dasein hängen und über spezielle Möglichkeiten verfügen, es zu erhalten. U.a. durch gezielte Einflussnahme auf all ihre „Bestandteile“, einschließlich der Menschen. Auch der bereits zum Vergleich herangezogene Baum lässt weder seine Wurzeln noch seine Äste oder Blätter einfach machen, „was sie wollen“.
Hätte die mehrfache Erfahrung katastrophaler Meteoriteneinschläge für „Gaia“ dann nicht ein Grund gewesen sein können, uns früher als vielleicht ursprünglich beabsichtigt aus der (relativen) mütterlichen Geborgenheit der matriarchalen Epoche zu vertreiben, uns zu intensiverer Aktivität und Verantwortungsübernahme zu zwingen, sozusagen den wissenschaftlich–technischen Fortschritt „auszulösen“ – vielleicht unter Zuhilfenahme der von James DeMeo beschriebenen verheerenden „Saharasia“–Wüstenbildung34, die jene massenhaften seelischen Deformationen verursacht zu haben scheint, welche schließlich zum Patriarchat führten?
Wäre es nicht möglich, dass die ansonsten erdverbundenere matriarchale Gesellschaft nicht oder zu spät zu jenem Entwicklungsstand gekommen wäre, den „Gaia“ schleunigst – was sind für die Erde schon 6.000 Jahre! – für nötig hielt? Dass jene Errungenschaften, die tolerante Feministinnen wie Sabine Lichtenfels35 dem Patriarchat zubilligen, wie „das objektive und historische Denken“, das Hineinbringen von „Analyse, Systematik und Ordnung in das Chaos der uns umgebenden Dinge“, aus Sicht von „Gaia“ für die Abwehr der nächsten dieser kosmischen Bedrohungen dringend erforderlich waren – so dringend, dass sie die ebenfalls abzusehenden negativen Auswirkungen „zähneknirschend“ mit in Kauf nahm? Dass sie, wie sonst auch, keine Chance hatte, es allen ihrer Bewohner recht zu machen, sondern sich zwischen zwei Übeln, zwei Gefährdungen ihres Daseins für die immer noch erträglichere Variante entscheiden musste?
Und ist es völlig ausgeschlossen, dass wir mit der Abwehr eines solchen Meteoritentreffers einen noch umfassenderen Schaden verhindern würden? Nachdem wir uns mittels der Chaostheorie mit der Möglichkeit angefreundet haben, dass der Flügelschlag eines australischen Schmetterlings Wirbelstürme im Atlantik auslösen kann, ist auch nicht mehr undenkbar, dass das Auslöschen des Planeten Erde kosmische Konsequenzen nach sich ziehen könnte – über die Vernichtung einer vielleicht einzigartigen Spielart des Lebens hinaus.
Bevor wir allerdings an die Übernahme derartig „überirdischer“ Verantwortung gehen könnten, müssten wir unsere Forschungs– und Produktionspotentiale von deren Einsatz für militärische Stärke, Maximalprofit und Umweltzerstörung abziehen und zusammenfügen. Eine grundsätzlich umgestaltete menschliche Gesellschaft dürfte die Folge sein – und vielleicht eine globale Verfassung, in deren Paragraph 1 „Erdschutz“ und „kosmische Befruchtung“ als Ziele definiert wären.
Sollten letztere Spekulationen nicht völlig haltlos sein, hätte das noch eine weitere Bedeutung: Es fänden doch soziale, gesellschaftliche Prozesse statt, für deren Ausrichtung „Vorgaben“ vorhanden sind – nicht an sich, sondern durch die Selbstorganisation „Gaias“.
Anders gesagt: Wenn wir nach sich selbst organisierendem Fortschritt suchen, nach Sinn für manche widersprüchliche Veränderung auf unserem Planeten, nach Höherentwicklung, an die wir uns „ankoppeln“ könnten, werden wir vielleicht am ehesten fündig in – im Wortsinne – globalen „Trends“. (Auch bei diesem „Ankoppeln“ ginge es dann weniger um etwas völlig Neues, sondern um ein bewussteres Fortführen von Verhaltens– und Denkweisen, die wir seit langem üben. Beispielsweise, wenn sich unsere Landwirtschaft der Abfolge von Warm– und Kaltzeiten anpasst. Oder wenn wir in unsere Zukunftsvisionen die „Kontinentaldrift“ mit einbeziehen oder den Zeitpunkt, an dem die Sonne aufhören könnte, uns zu wärmen.)
In dem Maße, wie wir lernen, durch „Gaias“ Augen zu schauen, ihre Lebensrhythmen, ihre Eingebundenheit in größere kosmische Zusammenhänge zu erfassen, können wir vielleicht verstehen, wohin die Reise geht – und was wir zu tun haben, um weiterhin mitreisen zu dürfen.
Bewusste Kompromisse statt irrealer Sprüche
Aber da wir gewollte und dringend benötigte Kinder der Erde zu sein scheinen, hat es andererseits auch keinen Sinn, uns künstlich klein und unwichtig zu machen – nach dem Motto „Wir brauchen die Natur, aber die Natur braucht uns nicht“. Würden wir diese Sprüche ernst nehmen und als Natur nur das ansehen, was nichtmenschlich ist, wäre die naturerhaltendste Verhaltensweise, die uns zu Gebote stünde, der unverzügliche kollektive Selbstmord.
Da wir aber selbst auch Teil der Natur sind, erscheint es mir sinnvoller – zusätzlich zu den weiterhin notwendigen Aktivitäten zum Schutz der nichtmenschlichen Natur – ohne lähmendes schlechtes Gewissen dazu zu stehen, dass wir uns als gleichwertigen und daher ebenfalls der Hilfe würdigen Bestandteil der Welt ernst nehmen.
Zum Beispiel so: Einerseits mindert der Schadstoffausstoß meines Autos die Lebensqualität des Baumes, der dort steht, wo ich parke. Andererseits hilft mir das Autofahren, Zeit zu sparen, spontaner andere Menschen und Gegenden zu sehen – meine Lebensqualität zu erhöhen. Statt automatisch davon auszugehen, dass die Bedürfnisse des Baumes ökologisch, meine aber unökologisch sind, sollte ich die Tatsache akzeptieren, dass hier zwei verschiedenartige Geschöpfe mit in diesem Fall sich widersprechenden Bedürfnissen aufeinandertreffen. Aber das Interesse an einer möglichst hohen Lebensqualität ist bei beiden berechtigt. Also sollte ich wohl die Aufgabe übernehmen, nach einem Kompromiss zu suchen – z. B. mehr Geld auszugeben für ein schadstoffärmeres Auto.
Und mehr als ein Kompromiss ist nicht und war noch nie erreichbar. Auch beim Bau eines energieautarken Holzhauses werden unzählige im Boden befindliche Lebewesen vernichtet. (Manches spricht sogar dafür, dass es für die – nichtmenschliche – Natur am besten wäre, wenn alle Menschen in wenige Megacitys zögen und dort in fünfziggeschossigen Betonkolossen hausten: Zersiedlung, Verlegung tausende Kilometer langer Energieleitungen, Straßenbau und vieles mehr könnte so unterbleiben, riesige Freiräume für Pflanzen und Tiere wären geschaffen.36) Bereits im Matriarchat bedeutete Besiedlung und Bekleidung auch Naturzerstörung. Selbst der Stoffwechsel eines vegetarischen Mönches beruht auf der Tötung pflanzlichen Lebens. Bei jedem Zähneputzen (ob mit oder ohne Zahnpasta) killen wir zuhauf Angehörige unserer Mundflora. Jeder Schritt, auch wenn ihn Angehörige einer Selbstversorger–Kommune auf biodynamisch bewirtschaftetem Boden machen, jeder Atemzug, auch wenn er einem „Om“ oder sonstigen Meditationssilben vorausgeht, kostet diverse Mikroorganismen die Existenz37 – und wenn wir gar alle Lebewesen als gleichberechtigt ansehen, machen auch Kleinheit und „niedriger“ Entwicklungsstand der Letzteren die Sache nicht besser.
Doch auch mit dieser Misere stehen wir nicht allein. Alle Tiere fressen Pflanzen oder Fleisch. Pflanzen verhindern dort, wo sie wachsen, das Erblühen konkurrierender Gewächse. Und „Mutter Natur“ selbst hat anscheinend Vernichtungen zu verantworten, deren Umfang weit über das hinausgeht, wozu der Mensch bislang imstande war. Durch Meteoriteneinschläge, Klimawechsel, Vulkanausbrüche u.ä. sollen ja nicht nur vor 65 Millionen Jahren die Dinosaurier ausgestorben sein. Bereits im Erdzeitalter Trias wurden auf diese Weise offenbar 35 Prozent aller Tierfamilien hinweggerafft. Im Perm scheint dasselbe Schicksal 95 Prozent aller Wasserbewohner ereilt zu haben, im Devon 30 Prozent der Tierfamilien, im Ordovizium sogar 50 Prozent38. Neunundneunzig Prozent aller Arten, die jemals die Erde bevölkert haben, sind nach gegenwärtigem Erkenntnisstand von Biologen nicht durch die Schuld des Menschen wieder verschwunden, sondern „einem natürlichen Aussterbeprozess zum Opfer gefallen“39.
„Du sollst nicht töten“ ist also in dieser Pauschalität nicht nur eine unerfüllbare Forderung – sondern auch eine unnatürliche.40 Wie alle realitätsfernen Normen lenkt sie ab vom Machbaren.
Was wäre machbar?
Vielleicht das: „Hilf Gaia, töte keinen Menschen und zerstöre auch ansonsten nicht mehr und nicht grausamer als unbedingt nötig“. Auch Urvölker haben nicht „besser“ gehandelt: Die spirituelle Verbundenheit mit dem Bären beispielsweise hat die Indianer nie daran gehindert, ihn – ob nun vor oder nach einem Dankritual – zu erlegen. Zu einer zeitgemäßen Variante davon könnte sich das Konzept der „nachhaltigen Nutzung“ der Natur entwickeln: eine Mischung aus Bewirtschaften und Schützen.41
„Der einzige Weg, der Natur beizustehen“, hat Max Horkheimer geschrieben, „liegt darin, ihr scheinbares Gegenteil zu entfesseln, das unabhängige Denken.“42
Wir haben also schon immer auch auf Kosten anderer gelebt. Nur: Inzwischen sind diese Kosten so enorm gestiegen, dass wir schnellstens dazu übergehen müssen, sie radikal zu verringern, wenn wir überleben wollen. Wir sind möglicherweise dabei, „Gaia“ in Entscheidungsnotstand zu bringen. Genügend Wissen und Geld, ausgearbeitete Technologien und Konzepte um stattdessen auch hier einen vernünftigen Kompromiss herzustellen, sind längst vorhanden43.
Aber dieses Wissen wird nur unzureichend verbreitet, dieses Geld wird nach wie vor ungerecht verteilt, diese Technologien werden zu wenig gefördert, diese Konzepte setzen sich nicht durch. Warum?
Trotz aller „übergeordneten Zusammenhänge“ scheint mir der Spielraum menschlichen Handelns so groß, dass wir keinem außermenschlichen Faktor die Hauptverantwortung dafür zuschieben können. „Politische Zwänge“ existieren oft ausschließlich in machtgeilen Politikerköpfen und freiheitsfürchtenden Untertanengeistern. „Ökonomische Gesetze“ werden nur am Leben gehalten durch diejenigen, die diese Ökonomie betreiben, sind von deren Motivationen und Konsum–Gewohnheiten abhängig – und daher veränderbar. (Und nachdem ich während der DDR–„Wende“ hautnah miterlebt habe, wie schnell für „objektiv“ und „ewig“ erklärte „Wahrheiten“ mitsamt der auf ihnen basierenden Institutionen sich in Luft auflösen können, bin ich sicher: Auch in Zukunft sind kurzfristig grundlegende Veränderungen möglich!)
Was einer notwendigen Umgestaltung entgegensteht, findet in allererster Linie in uns und zwischen uns statt. Es geht also, denke ich, vor allem um seelische und soziale Barrieren, die wir abbauen müssen, um unsere individuelle Selbstorganisation, die wir stärker in Gang setzen müssen; es geht darum, uns zunehmend in die Lage zu versetzen, die real vorhandenen Verbindungen zwischen uns und der Welt rational und emotional wahrzunehmen – und entsprechend zu handeln.
Die, die sich momentan bewusst um das Erreichen solcher Ziele bemühen, stellen sicherlich eine globale Minderheit dar. Aber:
– Dürfte nicht innerhalb der Erdbevölkerung zu dieser Minderheit doch eine recht große Zahl von Menschen gehören?
– Bringen nicht einige der „globalisierenden“ Prozesse die Wahrscheinlichkeit mit sich, dass sich diese Zahl weiter erhöht?
– Lässt unsere vielfältige Verbundenheit nicht darauf hoffen, dass wir, selbst dann, wenn wir nicht in direkten Kontakt zueinander treten, gemeinsame Wirkungen erzielen?
– Lassen nicht die Erfolge der Homöopathie die Hoffnung zu, dass auch in anderen Zusammenhängen kleine „Heilmittel-Mengen“ helfende Wirkungen auf einen Gesamtorganismus haben können – nämlich dann, wenn sie über die passende, von diesem Organismus benötigte „Information“ verfügen?
– Steht nicht vielleicht „Gaia“ auf unserer Seite?
– Könnten sich nicht Menschen, die sich für notwendige psychosoziale Veränderungen einsetzen, endlich intensiver mit jenen zusammenfinden, die sich für notwendige ökologische, ökonomische, kulturelle Umgestaltungen engagieren? Könnten nicht Wilhelm Reichs bislang an Ganzheitlichkeit wohl selten überbotene Forschungsansätze und -ergebnisse einen passenden Rahmen dafür bieten?
Wie wär´s zum Beispiel mit einem Weltkongress zum Thema „Globalisierung und Klimawandel – Mitverantwortung und Mitgestaltung“?
Falls uns so etwas oder Ähnliches gelingen sollte: Könnten wir dann nicht mit Sicherheit sehr viel zielgerichteter Einfluss nehmen auf die Erde – als ein Schmetterlingsflügel auf das Wetter?
*
Anmerkungen und Quellen
1) Den Hinweis auf diesen Unterschied verdanke ich – neben vielen anderen hier verarbeiteten Denkanstößen – meinem Freund John Erpenbeck (siehe auch J. Erpenbeck und V. Heyse „Die Kompetenzbiografie. Strategien der Kompetenzentwicklung durch selbstorganisiertes Lernen und multimedale Kommunikation“, Waxmann Verlag, Münster/ Berlin/ New York 1999).
2) siehe D. und I. Kerner: „Heilen. Das Energiesystem des Menschen“, Kiepenheuer & Witsch, Köln 1997 oder dieselben: „Das Licht des Lebens“ auf S. 417 in A. Peglau/ ich.ev: „Weltall, Erde, Ich. Anregungen für ein selbstbewussteres Leben“, U. Leutner Verlag Berlin 2000 (im Folgenden abgekürzt „WEI“. Die aus diesem Buch herangezogenen Texte sind auch zu finden unter www.weltall–erde–ich.de
3) siehe die Bücher von R. Sheldrake, u.a: „Die Wiedergeburt der Natur“, Scherz Verlag Bern, München, Wien.
4) W. Reich: „OROP Wüste“, Zweitausendeins Frankfurt/M 1995.
5) M. Gleich, D. Maxeiner, M. Miersch, F. Nicoley: „Life Counts. Eine globale Bilanz des Lebens“, Berlin Verlag 2000, S.28 f.
6) M. Chown: „Warum Gott doch würfelt. Über schizophrene Atome und andere Merkwürdigkeiten aus der Quantenwelt“, dtv München 2005, S. 18.
7) siehe D. Ash/ P. Hewitt: “Wissenschaft der Götter. Zur Physik des Übernatürlichen“, Zweitausendeins Frankfurt/M. 1998, v. a. S. 21–46. Aber bereits der allgemein anerkannte „Welle–Teilchen–Dualismus“ (oder auch Albert Einsteins Ausspruch, dass Materie gefrorene Energie sei) bedeutet doch wohl, dass wir uns – auch „schulphysikalisch“ – sowohl als materielle, wie auch als Energiewesen verstehen können.
8) Sudhir Kakar: „Kultur und Psyche. Die Auswirkungen der Globalisierung auf die Psychotherapie“, (mir freundlicherweise vom Autor zur Verfügung gestelltes) Manuskript eines Vortrags, gehalten auf dem Kongress “Grenzen. Psychotherapie und Identität in Zeiten der Globalisierung”, Weimar, Juni 2005.
9) Um einen äußerst umstrittenen, alternativen naturwissenschaftlichen Erklärungsansatz bemüht sich z.B. Nigel Calder in dem Buch „Die launische Sonne“, Dr. Böttiger Verlags GmbH, Wiesbaden 1997.
10) siehe z. B. H. Haken: „Erfolgsgeheimnisse der Natur. Synergetik: Die Lehre vom Zusammenwirken“, Rowohlt Verlag, Reinbek 1995, v. a. S. 49–94.
11) W. Reich: „Äther, Gott und Teufel“, Nexus Verlag Frankfurt/M. 1983, S. 108.
12) vgl. u.a. M. Solms, O. Turnbull: “Das Gehirn und die innere Welt”, Walter Verlag Düsseldorf/ Zürich 2004 oder J. C. Rüegg: „Psychosomatik, Psychotherapie und Gehirn. Neuronale Plastizität und biopsychosoziale Medizin“, Schattauer Verlag Stuttgart/ New York 2003.
13) J. C. Rüegg: „Psychosomatik …“ (wie Anm. 12), S. 19.
14) Ebd.
15) Der Ansicht, dass in Laserstrahlen, Lebewesen, Demokratien und Wirtschaftssystemen gleichartige Selbstorganisationsprozesse ablaufen, wie sie S. Kauffmann vertritt in der „Der Öltropfen im Wasser. Chaos, Komplexität, Selbstorganisation in Natur und Gesellschaft“, Piper Verlag München 1998 oder H. Haken in „Erfolgsgeheimnisse der Natur“ (wie Anm. 10) kann ich mich nicht anschließen.
16) J. H. Reichholf, „Der blaue Planet. Einführung in die Ökologie“, dtv, München 1998, S. 61ff.
17) J. Lovelock: „Gaia. Die Erde ist ein Lebewesen“, Scherz Verlag Bern München Wien 1992, S.79. Auch die im Folgenden beschriebenen Etappen der Erdentwicklung sind dort geschildert.
18) ebd., S. 11, auch: „WEI“ (wie Anm. 2), S. 430ff).
19) zum Beispiel von Reichholf (wie Anm. 16). Lovelock (wie Anm. 17, S. 30) zählt die Zentralsteuerung nicht dazu.
20) siehe z.B. J. C. Rüegg: „Psychosomatik …“ (wie Anm. 12).
21) siehe z.B. P. Pearsall, „Heilung aus dem Herzen. Die Körper–Seele–Energie und die Entdeckung der Lebensenergie“, Goldmann Verlag, München 1999.
22) Erich Jantsch: „Die Selbstorganisation des Universums. Vom Urknall zum menschlichen Geist“, Hanser Verlag München, Wien 1992, S. 381.
23) Sudhir Kakar: „Die Auswirkungen der Globalisierung auf die Psychotherapie“ (wie Anmerkung 8).
24) W. Reich: „Die Massenpsychologie des Faschismus“, Kiepenheuer & Witsch 1986, u.a. S. 75ff.
25) U.a. in H.-J. Maaz: „Der Gefühlsstau. Ein Psychogramm der DDR“, Argon–Verlag Berlin 1990, S. 105ff.
26) U.a. in W. Reich: „Äther, Gott und Teufel“ (s.o.), S. 66ff.
27) H.-J. Maaz: „Der Gefühlsstau“ (s.o.), S. 213 ff., siehe auch Maaz/ Peglau: „Psychische Revolution und therapeutische Kultur. Vorschläge für ein alternatives Leben“ (auch „WEI“ – wie Anm. 2, S. 110).
28) Siehe Bernd Senf: „Die Wiederentdeckung des Lebendigen“, Zweitausendeins Frankfurt/M 1996 (auch: „WEI“ – wie An. 2 -, S. 436ff).
29) Oder: Al Gore: „Eine unbequeme Wahrheit. Die drohende Klimakatastrophe und was wir dagegen tun können“, Riemann–Verlag München 2006. Das gleiche Thema behandelt – ebenfalls mit vielen konkreten Verbesserungsvorschlägen – Tim Flannery in „Wir Wettermacher. Wie die Menschen das Klima verändern und was das für unser Leben auf der Erde bedeutet“, S. Fischer Verlag Frankfurt a.M. 2006.
30) J. Reichholf, „Der blaue Planet“ (wie Anm. 16), S. 46.
31) Gleich u.a.: „Life Counts“ (wie Anm. 5), S. 272.
32) J. Reichholf „Der blaue Planet“ (wie Anm. 16), S. 127 und S. 115.
33) siehe H. Küster, „Geschichte der Landschaft in Mitteleuropa. Von der Eiszeit bis zur Gegenwart“, Beck–Verlag München, 1996.
34) James De Meo: „Entstehung und Ausbreitung des Patriarchats. Die Saharasia–Hypothese“, in „emotion 10“, Volker Knapp–Diederichs–Publikationen Berlin 1992. Vgl. auch https://weltall-erde-ich.de/james-de-meos-saharasia-these-von-der-wueste-zum-patriarchat-vom-patriarchat-zur-welt-verwuestung/
35) siehe A. Peglau, „Eine Einladung an die Männer“ („WEI“ – wie Anm. 2, S. 232 f) oder hier: Eine Einladung an die Männer.
36) Peter Huber: „Raus aus der Natur!“, in „Die Zeit“, 3.2.2000.
37) siehe L. Nilsson, „Eine Reise in das Innere unseres Körpers. Das Abwehrsystem des menschlichen Organismus“, Rasch und Röhring Verlag Hamburg 1987, S. 112ff.
38) siehe J. Reichholf, „Evolution – Fortschritt durch Katastrophen“, in Gleich u.a.: „Life Counts“ (wie Anm. 5), S. 24f.
39) Ebd., S. 132.
40) siehe auch W. Wickler „Die Biologie der zehn Gebote. Warum die Natur für uns kein Vorbild ist“, Piper Verlag München 1991.
41) Siehe D. Maxeiner/ M. Miersch „Öko–Optimismus“, Rowohlt Verlag, Reinbeck 1999, S. 226 ff sowie der gesamte Abschnitt „Nutzen und Schützen“ in Gleich u.a.: „Life Counts“ (wie Anm. 5), S.164ff.
42) Zitiert in Gleich u.a.: „Life Counts“ (wie Anm. 5), S. 144.
43) Siehe u.a. J. Randers, D. und D. Meadows: „Die neuen Grenzen des Wachstums“, DVA Stuttgart 1992 (auch „WEI“ – wie Anm. 2-, S. 395 ff); J. Rifkin: „Das Ende der Arbeit und ihre Zukunft“, Campus–Verlag Frankfurt/M. 1995 (auch „WEI“, S. 377); D. Duhm: „Geistige Evolution und neue Kultur“, emotion 3, Parallel–Verlag Berlin 1981 (auch „WEI“, S. 409 ff); B. Senf: „Fließendes Geld und Heilung des sozialen Organismus“ („WEI“, S. 427 ff), sowie A. Hammonds Buch: „Projekt Erde. Szenarien für die Zukunft“, Gerling Akademie Verlag München 1998.
Veröffentlicht in Emotion. Beiträge zum Werk von Wilhelm Reich, Heft 17 (2007), S. 99-122. Eine frühere Fassung erschien in A. Peglau/ ich e.v.: Weltall, Erde, … Ich. Anregungen für ein selbstbewussteres Leben“ bzw. weltall-erde-ich.de.