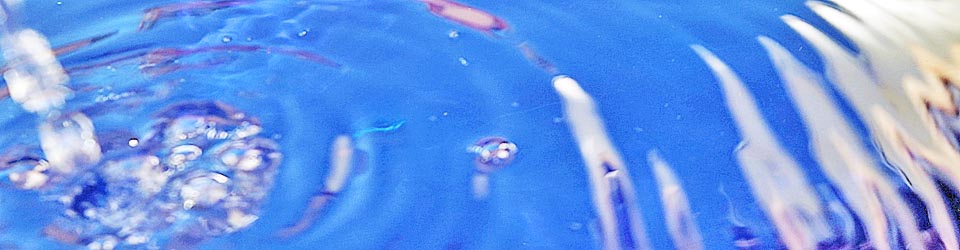von Andreas Peglau
Aus einem Vortrag, gehalten auf der Frühjahrstagung der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung in Kassel, am 6.6.2015.
*
… Lässt sich aus all dem, was ich Ihnen nun berichtet habe, der Schluss ziehen, es wäre wünschenswert, Reich – wie 1997, anlässlich seines 100. Geburtstages, gefordert wurde –, durch Wiederaufnahme in die Internationale Psychoanalytische Vereinigung (IPV) zu „rehabilitieren“?
Zum einen glaube ich nicht, dass Reich Wert darauf gelegt hätte, posthum erneut IPV-Mitglied zu werden. Zu schlecht waren die Erfahrungen, die er mit dieser Organisation machen musste. Es wäre ihm sicher auch nicht recht gewesen, einer Einrichtung als Aushängeschild zu dienen, deren Interessen – wie der 2011 erschienene Band „100 Jahre IPV“ unterstreicht –, vorrangig um Therapie und Vereinsstruktur kreisen.
Da Reich nachweislich ein aus der Masse seiner Berufskollegen im positiven Sinne herausragender Psychoanalytiker war, würde die Fragestellung, ob er einer erneuten IPV-Aufnahme „würdig“ ist, die Realität ohnehin auf den Kopf stellen.
Notwendig erscheint mir dagegen, im Umkehrschluss zu fragen, ob die heutige IPV eine würdige Verwalterin für Reichs psychoanalytisches Erbe sein könnte, ob sie insbesondere geeignet wäre, seine, Individuelles und Soziales zu revolutionären Schlüssen verbindenden Gedanken weiterzuführen. Nach allem, was mir bekannt ist, muss ich das bezweifeln.
Reich kann also, meine ich, auf posthume Ehrenmitgliedschaften in den Analyseverbänden gut verzichten. Aber diese Analyseverbände beschneiden sich in erheblichen Maße selbst, wenn sie weiterhin Reichs Erkenntnisse verdrängen.
Doch was würde passieren, wenn sie diese Verdrängung aufheben? Wie sähe eine an Wilhelm Reich orientierte Psychoanalyse aus? Passt sie hinein in eine „pluralistische“ Psychoanalyse, wie sie im Mittelpunkt dieser Tagung steht?
Zunächst: Es wäre eine Psychoanalyse ohne pessimistisch-individualistisches Menschenbild, ohne Aggressions- oder gar Todestrieb. Und das ist ja beileibe kein „alter Hut“. 2012 erfuhr man in einem Tagungsbericht: »Der Psychoanalytiker und Affektforscher Rainer Krause […] sprach über die ›Freude am Morden‹, die in uns allen angelegt sei.“ Im 2006 erschienenen Freud-Handbuch heißt es: Der Impuls, den Todestrieb »die Oberhoheit über Eros gewinnen zu lassen«, sei als Problem »heute allgegenwärtig«. Bereits 1976 hatte Peter Ziese konstatiert, »das Vorhandensein eines Aggressionstriebes [wird] in der analytischen Literatur nicht mehr bestritten«. Und auch wer einen Aggressionstrieb annimmt, suggeriert ja, Menschen seien biologisch vorgegeben gefährlich und damit permanent kontrollbedürftig, hat für Krieg, Mord und Gewalt ebenso schnelle wie falsche Erklärungsmuster zur Hand. Über die Todestriebtheorie urteilte Ziese zwar, dass diese »in der psychoanalytischen Literatur kaum mehr eine Rolle spielt« – referierte dann jedoch auf den nächsten Seiten ausgerechnet jene Analytikerin, die ausdrücklich an diesem Trieb festhielt: Melanie Klein. Da die »Kleinianer« inzwischen zu den mächtigsten Schulen der Psychoanalyse aufgestiegen sind und die ebenfalls einflussreiche Schule Jacques Lacans weiterhin auf die Existenz dieses Triebes setzt, muss man sagen: Der Todestrieb ist heute unter Analytikern populärer als zu Freuds Zeiten. Der Neurobiologe und Psychotherapeut Joachim Bauer formuliert daher ganz zu Recht in der Gegenwartsform: Der Aggressions- bzw. Todestrieb ist »der große Flop der Psychoanalyse«.
Eine Reichsche Psychoanalyse käme aber nicht nur ohne Todestrieb aus. Sie enthielte auch keinen angeblich unvermeidlichen Ödipuskomplex, keinen angeblich schicksalhaften Wiederholungszwang, kein Straf-»Bedürfnis«, keinen angeblich angeborenen Sadismus und Masochismus. Weder würde sie eine angeblich notwendige Triebunterdrückung oder -sublimierung propagieren noch eine vermeintlich wünschenswerte Selbstunterdrückung durch Abwehrmechanismen oder Fremdsteuerung durch Über-Ich-Implantate.
Schon Otto Fenichel hatte seine therapeutischen Intentionen unter dem Motto zusammengefasst: »Wo Über-Ich war, soll Ich werden!« – was natürlich gemeint war als Entgegnung auf Freuds: »Wo Es war, soll Ich werden!« Reich folgend, wäre sogar anzustreben, dass erst gar kein Über-Ich entsteht – und dass auch kein „Es“ verschwindet. Da Reich im »Es« die Basis für prosoziales Verhalten wahrnahm, konnte er sich nur wünschen, dass wir davon lebenslang profitieren.
Mit Reich wäre ebenfalls kein Katalog seelischer Störungen machbar, in dem zwar Menschen aufgelistet sind, die in belastenden Situationen erröten – nicht aber auch Staatslenker, die ohne jedes Erröten Krieg und Massenmord befehlen, nicht auch US-Präsidenten, die die halbe Welt in Brand setzen oder wöchentlich neue völkerrechtswidrige Drohnen-Exekutionen veranlassen.
Jeder Gedanke daran, Psychoanalytiker könnten eine „weiße Leinwand“ sein – eine Vorstellung, der ja schon Freud nicht entsprochen hat – ließe sich mit Reich erst recht nicht vereinbaren: Wo Analytiker notwendigerweise zu öffentlichkeitswirksamen Kritikern sozialer Missstände werden, ist dafür kein Platz.
Es würde also einiges wegfallen bei einer mehr an Reich orientierten Psychoanalyse. Was käme hinzu?
U.a. eine recht ganzheitliche Vorstellung von leib-seelischer Gesundung und tatsächlich möglicher psychischer Gesundheit, eine Schwerpunktsetzung auf Psycho-Prophylaxe, eine stärkere Einbeziehung von Gefühl – insbesondere Wut – und Körper in die Behandlung, Beschreibungen komplexer Wechselwirkungen zwischen Individuum und Gesellschaft, wie ich sie aus Reichs Massenpsychologie zitiert habe – sowie eine mit psychosozialen Fakten untersetzte Gesellschaftsutopie. Gerade mit Letzterem entstünde auch die Chance, dass die Psychoanalyse angemessene gesellschaftliche Relevanz und Popularität erhielte, konstruktiv-streitbarer Bestandteil gesellschaftlicher Selbstverständigung und Weiterentwicklung würde.
Aber wäre das, was ich hier skizziert habe, überhaupt noch Psychoanalyse? Wenn Reich mit seinen Thesen richtig lag – dann: Ja, natürlich. Wenn Psychoanalyse Wissenschaft sein will, kann mit „Pluralität“ nicht gemeint sein, wahllos alles zu sammeln, was sich jemals Psychoanalyse nannte – egal wie realitätsfern es ist. Sondern nur: alles aufzunehmen, was hilft, die objektive Realität genauer widerzuspiegeln – auch wenn es bisherigen Ansichten zuwiderläuft. Psychoanalyse, definierte Freud 1917, »beabsichtigt und leistet nichts anderes, als die Aufdeckung des Unbewußten im Seelenleben«.
Reichs Erkenntnisse und Fragestellungen helfen meiner Ansicht nach ganz entschieden sowohl beim Erkennen der Realität wie auch beim Aufdecken von Unbewusstem. Und sie knüpfen – auch in ihren sozialkritischen Aspekten – kreativ an Freud an.
Dieser schrieb 1910, die »Aufklärung der Masse« sei die »gründlichste Prophylaxe der neurotischen Erkrankungen«, forderte die Analytiker auf, daran mitzuwirken. Er ergänzte: »Die Gesellschaft muß sich im Widerstand gegen uns befinden, denn wir verhalten uns kritisch gegen sie; wir weisen ihr nach, daß sie an der Verursachung der Neurosen selbst einen großen Anteil hat«. Mehrfach machte er deutlich, dass sich damit für ihn die Forderung nach sozialen Umwälzungen verband.
So hieß es 1927 in Die Zukunft einer Illusion:
»Wenn aber eine Kultur es nicht darüber hinaus gebracht hat, daß die Befriedigung einer Anzahl von Teilnehmern die Unterdrückung einer anderen, vielleicht der Mehrzahl zur Voraussetzung hat, und dies ist bei allen gegenwärtigen Kulturen der Fall, so ist begreiflich, daß diese Unterdrückten eine intensive Feindseligkeit gegen die Kultur entwickeln, die sie durch ihre Arbeit ermöglichen, an deren Gütern sie aber einen zu geringen Anteil haben. […]
Es braucht nicht gesagt zu werden, daß eine Kultur, welche eine so große Anzahl von Teilnehmern unbefriedigt läßt und zur Auflehnung treibt, weder Aussicht hat, sich dauernd zu halten, noch es verdient.«
Ziel müsse sein, schrieb er, eine Kultur, „die keinen mehr erdrückt“. Konsequente Psychoanalyse war also schon immer auch Gesellschaftskritik – und das Bemühen um entsprechende Gesellschaftsveränderung.
Ließe sich eine solche realitätsgerechte und sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusste Psychoanalyse wiederbeleben, würde sie zum Kernbestandteil einer „pluralistischen“ Analyse, wäre sie zugleich ein wesentlicher Faktor, um die globalen Probleme des 21. Jahrhunderts konstruktiv zu lösen, den drohenden ökologischen Kollaps abzuwenden und die steigende Kriegsgefahr zu verringern.
Ich glaube: Ohne Einbeziehung einer solchen Psychoanalyse lassen sich diese Probleme überhaupt nicht lösen.
Die Frage, was Psychoanalytiker und Psychoanalytikerinnen hier und heute für die Erhaltung des Friedens – wenigstens da, wo überhaupt noch von Frieden gesprochen werden kann, also nicht zuletzt in Mitteleuropa – tun können und tun sollten, ist aus meiner Sicht sogar der mit Abstand wichtigste Grund, warum eine tiefgründige Auseinandersetzung mit Reich innerhalb der Psychoanalyse dringend – erstmals – auf die Tagesordnung gesetzt werden sollte.
*
Auszug aus „Wilhelm Reichs Bedeutung für die Psychoanalyse – seine Ausgrenzung als negative Zäsur, seine Re-Integration als Chance“, Vortrag, gehalten auf der Frühjahrstagung der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung in Kassel, am 6.6.2015, veröffentlicht in Allert, Gebhard/Rühling, Konrad/ Zwiebel, Ralf (Hg.): Pluralität und Singularität in der Psychoanalyse, Gießen: PsychosozialVerlag, S. 450–473.
Tipp zum Weiterlesen:
Die politische Psychoanalyse und ihr verdrängter Exponent Wilhelm Reich