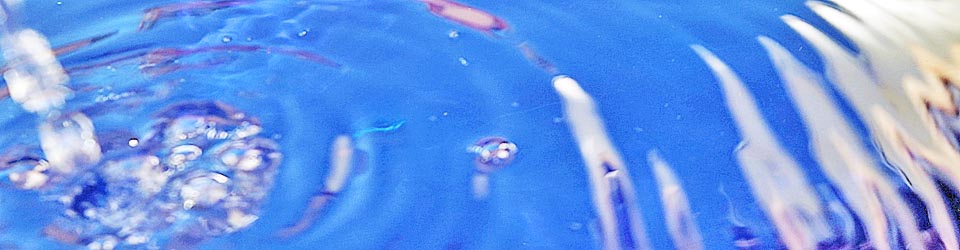von Andreas Peglau[1]
*
Jeder und jede von uns hat – zumindest unbewusst – ein Menschenbild: Annahmen darüber, wie Menschen im allgemeinen sind, gut oder böse, lern- und veränderungsfähig oder nicht, zuverlässig oder unzuverlässig, faul oder fleißig, unter welchen Umständen sie sich wohlfühlen, wie sie in einer bestimmten Situation reagieren, was sie glücklich, traurig oder wütend macht, was sie antreibt, wodurch sie beeinflusst werden können usw. Je nach dem, was wir diesbezüglich für zutreffend halten, beurteilen wir auch, welche Ursachen und Abhilfemöglichkeiten es für negative soziale Entwicklungen gibt – wie die rechtsextremistischen.
Unterschiedliche Menschenbilder führen dabei zwangsläufig zu unterschiedlichen Ergebnissen.[2] Je weniger ein Menschenbild die Realität erfasst, desto weniger taugt es als Grundlage sinnvollen Handelns. Das lässt sich anhand zentraler Thesen von Sigmund Freud und Wilhelm Reich verdeutlichen.
Der Mensch als asoziales Wesen
Der alte Freud hielt den Menschen für eine »wilde Bestie«, »der die Schonung der eigenen Art fremd ist«; der Mensch sei nun einmal »des Menschen Wolf«.[3] Seinen Glauben an die Existenz eines »Todestriebes«[4] teilen viele der heutigen Psychoanalytiker.[5]
Wer so denkt, muss Menschen für grundsätzlich gefährlich, gewaltbereit und destruktiv halten – von Geburt an. Bei dem Analytiker Franz Alexander las sich das dann so: Wenn das Kind auf die Welt komme, sei es
»nicht im geringsten an die Anforderungen des sozialen Lebens angepaßt; es ist […] ein asoziales Wesen. […] Diese Wahrheit wurde von Diderot vorweggenommen in seiner Behauptung, daß das ganz kleine Kind der zerstörungswütigste Verbrecher wäre, wenn es nur die Kraft hätte, seine Aggressionen auszuführen.«[6]
Doch auch wer – wie der Verhaltensforscher Konrad Lorenz – »nur« einen angeborenen Aggressionstrieb postuliert, kommt zu dem Ergebnis: Ohne äußere Anlässe oder Notwendigkeit drängen unsere biologischen Vorgaben zu regelmäßiger aggressiver Abfuhr – wir sind genetisch programmierte Zeitbomben.[7]
Solche fatalistischen Sichtweisen lassen sich zur Rechtfertigung staatlicher Gewalt und unterdrückender Erziehung nutzen – und werden dafür auch genutzt.[8]
Schon Sigmund Freuds, sich der Kindertherapie widmende Tochter Anna behauptete, »Zerstörungslust«, »Grausamkeit«, »Schamlosigkeit und Neugier« seien »Ausflüsse der infantilen Sexualregungen«. Daraus leitete sie ab: »Der Erzieher ist verpflichtet, die Triebbefriedigungen zu stören, zu erschweren und in vielen Fällen zu verhindern«.[9]
Darüber hinaus hat man damit für alles »Böse«, für Mord, Krieg, Faschismus, Rechtsextremismus sowie für kindliche Fehlentwicklungen bereits eine Pseudoerklärung parat[10] und muss über psychosoziale Ursachen, grundsätzliche Veränderungsmöglichkeiten und persönliche Verantwortung nicht zwingend tiefer nachdenken.[11]
Die sich aus solchen Sichtweisen ergebenden »Lösungen« liegen auf der Hand: Triebunterdrückung, Kontrolle, Abschreckung. Freud ergänzte: Sublimierung, Umleitung der Energie des Todestriebes zur Stärkung des Über-Ichs – also intensivere Selbstunterdrückung – sowie Stärkung des Lebenstriebes »Eros« als vermeintlichen Gegenspieler des Todestriebes.[12] Das lief vor allem auf den Vorschlag hinaus, durch Therapie eine seelische Umstrukturierung beim Einzelnen herzustellen.
Da auch Freud sich über die Unmöglichkeit im Klaren war, Psychoanalyse flächendeckend anzuwenden, heißt das: Er hatte keinen realisierbaren Vorschlag, wie »das Böse« auch nur zu beherrschen wäre. Es an der Wurzel zu packen, hielt er sowieso für ausgeschlossen. Von seinem Menschenbild auszugehen, erschwert daher, effektiv auf Rechtsextremismus zu reagieren.
Der Mensch als prosoziales Wesen
Die Absurdität der Todestriebhypothese hat bereits Wilhelm Reich vielfach aufgezeigt, beginnend 1932 mit seinem Artikel Der masochistische Charakter. Eine sexualökonomische Widerlegung des Todestriebes und des Wiederholungszwanges.[13]
Die bei Weitem ausführlichste und schlüssigste Widerlegung dieser Hypothese bietet anhand zahlreicher Belege aus Psychoanalyse, (Sozial-)Psychologie, Paläontologie, Anthropologie, Neurophysiologie, Tierpsychologie und Geschichtswissenschaft Erich Fromms 1973 publizierte Anatomie der menschlichen Destruktivität.[14] Auch die moderne Neurobiologie und -psychologie hat die Vorstellung eines angeborenen »Bösen« vielfach entkräftet und stattdessen eine angeborene Fähigkeit zu konstruktivem prosozialen Verhalten nachgewiesen.[15]
Den Beweis dafür kann sich jeder und jede auf einfache Weise selbst verschaffen: durch Kontakt zu sehr kleinen Kindern und bewusste Wahrnehmung von deren intensiven Interesse an liebevoller Bezogenheit und ihrer Fähigkeit zu situationsangemessener Aggressivität.
Wilhelm Reich sprach in der dritten Ausgabe der Massenpsychologie des Faschismus diesbezüglich von einem »biologischen Kern«, der dem Menschen ermögliche, »ein unter günstigen sozialen Umständen ehrliches, arbeitsames, kooperatives, liebendes, oder, wenn begründet, rational hassendes Tier« zu sein sowie von der angeborenen Fähigkeit zur »Selbstregulation«.[16]
Schon Pflanzen haben eine Art inneren Bau- und Entwicklungsplan, »wissen«, was nötig ist, um ihn zu erfüllen: Licht, Wasser, Nährstoffe usw.[17] Menschen kommen diesbezüglich mit einem noch weit ausgefeilteren inneren »Kompass« auf die Welt, spüren, was sie brauchen: nicht zuletzt Zärtlichkeit, Kontakt, Kommunikation, angemessenen Gefühlsausdruck – und andere Menschen. Nicht um diese zu zerstören und zu quälen, sondern um gut versorgt, im weiteren Wachstum gefördert zu werden, positive Bezogenheit zu erfahren, lieben zu können und geliebt zu werden. Ein »asozialer«, gar »todestriebgesteuerter« Säugling wäre nicht lebensfähig.
Der destruktiv gemachte Mensch
Es gibt eine beeindruckende, surreale Szene am Ende des 1985 gedrehten sowjetischen Spielfilms Geh und sieh von Elem Klimow.[18] Der Junge, dessen ganze Familie durch die faschistische Armee ermordet wurde, in dessen Heimat Weißrussland hunderte Dörfer in Schutt und Asche gelegt wurden, der gerade um ein Haar einem Massaker entkommen ist, schießt auf ein Porträtfoto des »Führers«. Mit jedem Schuss wird Hitler ein Stück jünger. Schließlich sitzt der kleine Adolf auf dem Arm seiner Mutter. Da hört der Junge auf, zu schießen.
Erich Fromm hat ausführlich beschrieben, wie Adolf Hitler im Laufe seines Lebens erst allmählich jene Züge annahm, die ihn dann – im Wechselspiel mit anderen Faktoren – zum Verbrecher werden ließen.[19] Mit Sicherheit ist Hitler nicht als Monstrum auf die Welt gekommen.
Wer sich mit der Lebensgeschichte des 1897, im selben Jahr wie Wilhelm Reich geborenen Joseph Goebbels befasst,[20] stößt in dessen Jugendzeit auf einen Schwärmer. Er schreibt Gedichte, Theater- und Klavierstücke, liest neben anderen Gottfried Keller, Theodor Storm, Schiller und Goethe. Er verliebt sich und hofft auf ein Leben voller Liebe und Anerkennung. Daran, dass diese Hoffnung zusehends scheitert, hat sein im Kindesalter entstandener Klumpfuß Anteil, besser gesagt: die negativen Reaktionen auf diese Behinderung. Für seine streng katholischen Eltern stellt sie eine »Heimsuchung« dar, die am besten zu verleugnen sei. Bei Verwandten und Mitschülern löst sie Abneigung bis Abscheu aus, später auch bei manchen Frauen.
Allmählich schiebt sich anstelle der unerfüllten Liebe zu anderen Menschen das Ersatzobjekt »Vaterland« in den Vordergrund; 1914 teilt er bereits die »nationale Euphorie« beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Doch noch 1919, als »völkisch« eingestellter 22-Jähriger, bewirbt sich Joseph Goebbels bei einem jüdischen Professor erfolgreich um eine Promotion und urteilt über diesen, er sei »ein außerordentlich liebenswürdiger« und »zuvorkommender Mann«.[21]
1920 reflektiert er den zunächst siegreichen »linken« Massenaufstand in Westdeutschland gegen reaktionäre Freikorps und Reichswehr so: »Rote Revolution im Ruhrgebiet (…) Ich bin aus der Ferne begeistert«.[22] Seiner Freundin schreibt er: »Dieser Kapitalismus hat nichts aus der neuen Zeit gelernt, und will nichts lernen, weil er seine eigenen Interessen vor die der anderen Millionen setzt.«[23]
Auf der Suche nach einem »Genie«,[24] das ihn und Deutschland erlösen möge, hört er 1921 erstmals von Hitler – und ist enttäuscht. Er reimt: »Seh ich nur ein Hakenkreuz, krieg ich schon zum Kacken Reiz.«[25]
Berufliche und private Frustrationen, Arbeitslosigkeit, Hunger, Existenzunsicherheit[26] folgen, seelische Probleme häufen sich: Sinnlosigkeitsgefühle, Suizidgedanken, Alkoholmissbrauch, Nervenzusammenbrüche. »Phasen tiefer Depression« wechseln nun mit »Ausbrüche[n] fanatischen Willens«.[27]
1922 – »Vaterlandsliebe« ist ihm inzwischen »Gottesdienst« geworden[28] – erfährt er von seiner Verlobten, dass sie »Halbjüdin« sei. Er ist zwar irritiert, beendet die Beziehung aber zunächst nicht.[29]
1924 kann er dem Kapital von Karl Marx noch immer positive Seiten abgewinnen.[30]
Bald freilich werden solche Haltungen in ihm wie ausgelöscht sein. Nationalsozialistische Ideologie und Führerkult gestatten ihm, Minderwertigkeitsgefühl und Depression durch einen fast permanenten Fanatismus niederzuhalten. Jetzt »formt« sich für ihn »[d]roben am Himmel eine weiße Wolke zum Hakenkreuz«.[31]
Im April 1926 schreibt er an Hitler:
»Dann mag ein Tag kommen, an dem alles zerbricht. Wir zerbrechen dann nicht. Dann mag eine Stunde kommen, wo der Mob um Sie geifert und grölt und brüllt: ›kreuzigt ihn!‹; wir stehen dann eisern und rufen ›Hosiannah!‹. Dann steht um Sie die Phalanx der Letzten, die selber mit dem Tode nicht verzweifeln. Der Stab der Charaktere, die Eisernen, die nicht mehr leben wollen, wenn Deutschland stirbt.«[32]
Der geifernde Juden- und Kommunistenhasser und bedingungslose Gefolgsmann Hitlers ist fertig. Dieser Prozess dauerte allerdings fast 30 Jahre – wäre also wohl auch 30 Jahre lang zu stoppen gewesen, wenn auch zunehmend schwerer.
Autoritäre Erziehung
Auch heute gilt: Selbst Politiker und Politikerinnen, die skrupellos den Mord an Einzelnen oder Massen befehlen, selbst Söldner oder Glaubensfanatiker, die diese Morde dann begehen, selbst Unternehmer, die gewillt sind, Frieden und ökologische Lebensgrundlagen ihren Profitinteressen zu opfern, selbst Faschisten, die Andersdenkende oder »Fremde« verhetzten und massakrieren, sind vor wenigen Jahrzehnten mit einem gesunden Potential und der Fähigkeit zur Selbstregulation auf die Welt gekommen, wollten und konnten lieben.
Woran liegt es, wenn dieses Potential sich nicht entfaltet hat? An dem, was viele als »ganz normale Erziehung« bezeichnen dürften.[33]
Kinder sind in keiner Weise weniger wert als Erwachsene, haben aber im Vergleich zu Letzteren kaum Möglichkeiten, über ihre Lebensumstände selbst zu bestimmen. In einer Welt, die hochgradig von neurotisierten Erwachsenen gestaltet wird, ist daher für die Entfaltung gesunder Kinder wenig Platz. Autoritär strukturierte Erzieherinnen und Erzieher suchen zumal immer wen, der weit genug »unten« ist, um gefahrlos »getreten« werden zu können.[34] Kinder sind so gesehen immer »unten«.[35] Die sich daraus für sie ergebenden Leiden und Entbehrungen, ihre vielfach unzureichend befriedigten Bedürfnisse verursachen Trauer, Schmerz und Wut – die in aller Regel gegenüber den Erziehungspersonen nicht adäquat zum Ausdruck gebracht werden dürfen. Sie stauen sich daher an, bis sie destruktive Ausmaße annehmen: Das von Reich »mittlere Charakterschicht« genannte Phänomen mit seinen sadistischen Impulsen entsteht – und wird in auf Ausbeutung beruhenden Wirtschaftssystemen später durch Erniedrigungen in der Arbeitssphäre verstärkt.
Da auch solcherart angestaute Gefühle offiziell zumeist nicht ausgelebt werden dürfen, werden sie verborgen hinter einer Fassade sozialer Angepasstheit, Höflichkeit[36] und Nettigkeit.
Bedrohliche Konsequenzen
So pflanzt sich auch in der nächsten Generation der von Reich bereits 1930 beschriebene, nach oben buckelnde, nach unten tretende autoritäre Charakter fort.[37]
Und diese Art seelischer Gestörtheit hat im Gegensatz zum meisten, was als »neurotisch« in medizinischen Diagnoseverzeichnissen auftaucht, von Platzangst bis depressiver Episode, höchst bedenkliche Konsequenzen für das gesamte Sozialgefüge.[38] Nicht zuletzt, weil die destruktiven Emotionen bei gegebenem Anlass jederzeit aus ihrem Versteck hervorbrechen können – dies umso leichter, wenn als Zielobjekte dafür sozial Schwächere zur Verfügung stehen.
Mit diesem Menschenbild ist auch der grundsätzliche Mechanismus skizziert, wie laut Reich gesunde Kinder neurotisiert und zu psychosozialen Zeitbomben gemacht werden – und damit auch zu potentiellen Rechtsextremisten. Denn je destruktiver Menschen werden, desto verwendbarer sind sie für destruktive Zwecke, ob diese nun mit nationalistischen, neofaschistischen, fundamentalistischen, imperialistischen, umweltzerstörerischen, kinder-, frauen-, homosexuellen- oder ausländerfeindlichen Ideologien verbrämt werden.
Wird der explosiven Wut ein Ventil geboten, sind die Gesinnungen austauschbar: Terror und Mord lassen sich ebenso mit dem Alibi »rechter« wie »linker« Weltanschauung verüben, zur Ehre Gottes, zum Heile Allahs, zugunsten einer Öko-Diktatur oder als Bestandteil neoliberaler, „regelbasierter“ Weltbeglückung.
***
[1] Dieser Text ist ein leicht bearbeiteter Auszug meines 2017 erschienenen Buches Rechtsruck im 21. Jahrhundert – Wilhelm Reichs „Massenpsychologie des Faschismus“ als Erklärungsansatz (S. 60-67). Hier kann es komplett kostenlos heruntergeladen werden: https://andreas-peglau-psychoanalyse.de/rechtsruck-im-21-jahrhundert-buchdownload/
[2] Verschiedene Schwerpunkte setzende Überblicke finden sich in Fahrenberg 2011; Danzer 2011, Petzold 2015.
[3] Freud 1930, S. 471.
[4] Freud unterschied zwischen einem angeblich in allem Lebendigen wirkenden Todestrieb und einem menschlichen Aggressionstrieb als dessen »Abkömmling und Hauptvertreter« (ebd., S. 481, siehe auch Peglau 2018b). Viele Analytiker vermischten dies schon Freuds Lebzeiten ohne weitere Diskussion (Peglau 2017a, S. 146-149). Für ein angeboren soziales Wesen hielt Freud den Menschen allerdings auch vor Entstehung der Todestrieb-These nie.
[5] Schon weil die einflussreichen psychoanalytischen Schulen von Melanie Klein und Jacques Lacan auf die Existenz des Todestriebes setzen, muss man sagen: Der Todestrieb ist heute in der Psychoanalyse populärer als zu Freuds Zeiten. Bezüglich des Aggressionstriebes konstatierte Peter Ziese (1982, S. 341), dass dessen »Vorhandensein […] in der analytischen Literatur« im Wesentlichen »nicht mehr bestritten« werde. Der Neurobiologe und Psychotherapeut Joachim Bauer (2011, S. 16) formuliert daher ganz zu Recht in der Gegenwartsform: Der Aggressions-bzw. Todestrieb ist »der große Flop der Psychoanalyse«.
[6] Alexander 1938, S. 69.
[7] Vgl. Fromm 1989d, S. 13-30.
[8] So beruft sich der Historiker Jörg Baberowski, dessen Credo lautet, »Nur klare, regelkonforme und notfalls mit Gewalt durchsetzbare Machtverhältnisse können uns […] vor zügelloser Gewalt schützen« (Baberowski 2016, Rückumschlag), mehrfach auf Freud (ebd., S. 148).
[9] A. Freud, 1932a, S. 15; 1932b, S. 395.
[10] Dass von dieser Möglichkeit beizeiten Gebrauch gemacht wurde, belegt die unter dem Motto »Psychoanalyse und Politik« stehende Ausgabe der Zeitschrift Psychoanalytische Bewegung vom September/ Oktober 1931. Darüber, wie Kriege zustande kommen, erfuhr man dort zum Beispiel: »Das Es gibt dem Ich den Auftrag, Kanonen zu bauen und zündet dann die Lunten an, ohne das Ich zu fragen«; sinnvoller als Abrüstung sei, dem Todestrieb Ersatzbefriedigungen anzubieten, zum Beispiel öffentliche Hinrichtungen (Peglau 2017a, S. 146-149).
[11] Auch Konrad Lorenz` Theorie des »Aggressionstriebes« lässt sich daraufhin befragen, ob der Autor damit nicht eigene Schuldgefühle über seine Verstrickung ins NS-System reduzieren wollte (https://www.gwup.org/infos/themen/107-sonstige-themen/734-der-so-genannte-aggressionstrieb).
[12] Freud 1930, S. 481-493.
[13] Reich 1932c.
[14] Fromm 1989d.
[15] Hüther 2003, 2010; Solms/Turnbull 2004, S. 138ff., 148; Tomasello 2010; Klein 2011; Bauer 2011. Auch Erwin Wagenhofers 2013 veröffentlichte Filmdokumentation Alphabet – Angst oder Liebe illustriert das auf berührende Weise (http://www.alphabet-film.com/).
[16] Reich 1986, S. 11.
[17] Wohlleben 2015. Ausführlich zu Selbstorganisation und Psyche: Peglau 2007.
[18] https://de.wikipedia.org/wiki/Komm_und_sieh
[19] Fromm 1989d, S. 335-393.
[20] Siehe Goebbels 1992; Longerich 2010; Reuth1991, dort zum Folgenden insbesondere S. 11-75.
[21] Ebd., S. 52.
[22] Ebd., S. 47.
[23] Ebd., S. 48.
[24] Ebd., S. 54.
[25] Ebd., S. 52.
[26] Ebd., S. 68-73.
[27] Ebd., S. 63.
[28] Ebd., S. 57.
[29] Ebd., S. 73.
[30] Longerich 2010, S. 58.
[31] Reuth 1991, S. 104.
[32] Ebd., Rückumschlag.
[33] Was Goebbels betrifft, sind die Informationen über seine Kindheit spärlich und, da sie zum großen Teil von ihm selbst stammen, kaum objektiv. Sein Vater sei »von preußischer Geradheit« gewesen, dessen Liebe zu Frau und Kindern habe sich darin gezeigt, sie »durch kleine Finessen und Schikanen zu quälen«. Joseph und seine Geschwister fürchteten seine »spartanische Zucht«. Die Mutter schildert er als schwermütig und ausgesprochen »schlicht«, meinte aber, sie habe »die Liebe, die sie ihrem Manne schuldig geblieben« sei, dem Sohn Joseph geschenkt. Insbesondere sie erzog ihn offenbar zu autoritärer, ritualisierter Gottesfurcht (Reuth 1991, S. 13f.).
[34] Dass strikt autoritäre, ausdrücklich auf »Gehorsam« ausgerichtete Erziehung hierzulande keinesfalls »out« ist, belegen die Publikationen des ehemaligen Leiters der Salem-Schule, Bernhard Bueb und ihre positive Aufnahme in Medien wie der Bild-Zeitung (ausführliche Kritik von Buebs Konzept in Brumlik 2007).
[35] Siehe auch Guddat/Tsokos 2014.
[36] Dass Goethe im zweiten Teil des Faust den Baccalaureus sagen lässt, »Im Deutschen lügt man, wenn man höflich ist«, halte ich für eine interessante Übereinstimmung.
[37] Siehe Peglau 2018a.
[38] Vermutlich taucht diese Art von Gestörtheit in Diagnoseverzeichnissen wie dem ICD 10 nicht auf, weil sie so »normal« (im Sinne von üblich) oder gar unbewusst gewünscht ist, dass sie gar nicht als krank wahrgenommen wird. Wird sie von Machthabern agiert, wird zumeist ohnehin nicht von Störung gesprochen, sondern von politischem Handeln. An anderer Stelle (Peglau 2015a, S. 468) habe ich dazu geschrieben: »Mit Reich wäre ebenfalls kein Katalog seelischer Störungen machbar, in dem zwar Menschen aufgelistet sind, die in belastenden Situationen erröten – nicht aber auch Staatslenker, die ohne jedes Erröten Krieg und Massenmord befehlen, nicht auch US-Präsidenten, die die halbe Welt in Brand setzen lassen oder wöchentlich neue völkerrechtswidrige Drohnen-Exekutionen anordnen.«
Quellen
Alexander, Franz (1938): Psychoanalyse und soziale Frage, Almanach der Psychoanalyse 1938, Wien: Int. Psych. Verlag, S. 64-83.
Baberowski, Jörg (2016): Räume der Gewalt, Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung.
Bauer, Joachim (2011): Schmerzgrenze. Vom Ursprung alltäglicher und globaler Gewalt, München: Blessing.
Brumlik, Micha (Hg.) (2007): Vom Lob der Disziplin. Antworten der Wissenschaften auf Bernhard Bueb, Weinheim/Basel: Beltz.
Danzer, Gerhard (2011): Wer sind wir? Anthropologie für das 21. Jahrhundert. Mediziner, Philosophen und ihre Theorien, Ideen und Theorien und Konzepte, Berlin/ Heidelberg: Springer.
Freud, Anna (1932a): Psychoanalyse des Kindes, Zeitschrift für psychoanalytische Pädagogik, 6. Jg., H. 10, S. 1-11.
Freud, Anna (1932b): Erzieher und Neurose, Zeitschrift für psychoanalytische Pädagogik, 6. Jg., H. 10, S. 393-402.
Freud, Sigmund (1930) [1929]: Das Unbehagen in der Kultur, in ders.: GW Band 14, Frankfurt/M.: Fischer, S. 419-506.
Fromm, Erich (1989d): Die Anatomie der menschlichen Destruktivität, in ders.: Gesamtausgabe, Bd. 7, München: dtv.
Goebbels, Joseph (1992) [1990]: Tagebücher 1924-1945 in fünf Bänden, hg. von Reuth, Ralf Georg, München/ Zürich: Piper.
Guddat, Saskia/Tsokos, Michael (2014): Deutschland misshandelt seine Kinder, München: Droemer/Knaur.
Hüther, Gerald (2003) [1999]: Die Evolution der Liebe. Was Darwin bereits ahnte und die Darwinisten nicht wahrhaben wollen, Göttingen: Vandenhoeck/Ruprecht.
Hüther, Gerald/Krens, Inge (2010) [1999]: Das Geheimnis der ersten neun Monate. Unsere frühesten Prägungen, Weinheim: Beltz.
Klein, Stefan (2011) [2010]: Der Sinn des Gebens. Warum Selbstlosigkeit in der Evolution siegt und wir mit Egoismus nicht weiterkommen, Frankfurt/M.: Fischer.
Longerich, Peter (2010): Goebbels. Biographie, München: Siedler.
Peglau, Andreas (2007) [2000]: Weltall, Erde, Ich – und „Gaia“. Über sinnvolles Handeln innerhalb einer widersprüchlichen Einheit. Über sinnvolles Handeln innerhalb einer widersprüchlichen Einheit. Ein Versuch, mit Hilfe von Erich Fromm, Sudhir Kakar, James Lovelock, Hans-Joachim Maaz, Wilhelm Reich, Rupert Sheldrake und anderen, Psychoanalyse und Ökologie zu verbinden (https://andreas-peglau-psychoanalyse.de/weltall-erde-ich-gaia/)
Peglau, Andreas (2015b): Wilhelm Reichs Bedeutung für die Psychoanalyse – seine Ausgrenzung als negative Zäsur, seine Re-Integration als Chance, in Allert, Gebhard/ Rühling, Konrad/ Zwiebel, Ralf (Hg.): Pluralität und Singularität in der Psychoanalyse, Gießen: Psychosozial, S. 450-473.
Peglau, Andreas (2017a) [2013]: Unpolitische Wissenschaft? Wilhelm Reich und die Psychoanalyse im Nationalsozialismus, Gießen: Psychosozial.
Peglau, A. (2018a): Vom Nicht-Veralten des „autoritären Charakters“. Wilhelm Reich, Erich Fromm und die Rechtsextremismusforschung, in: Sozial.Geschichte Online / Heft 22 / 201, S. 91-122 (https://duepublico2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00045266/05_Peglau_Autoritarismus.pdf).
Peglau, A. (2018b): Mythos Todestrieb – Über einen Irrweg der Psychoanalyse (https://andreas-peglau-psychoanalyse.de/wp-content/uploads/2018/07/Mythos-Todestrieb-pid_2018_02_Peglau.pdf)
Petzold, Hilarion G. (Hg.) (2015): Die Menschenbilder in der Psychotherapie. Interdisziplinäre Perspektiven und die Modell der Therapieschulen, Bielefeld: Aisthesis.
Reich, Wilhelm (1932c): Der masochistische Charakter. Eine sexualökonomische Widerlegung des Todestriebes und des Wiederholungszwanges, Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse Bd. 18, S. 303-351.
Reuth, Ralf G. (1991) [1990]: Goebbels, München/Zürich: Piper.
Solms, Mark/Turnbull, Oliver (2004): Das Gehirn und die innere Welt. Neurowissenschaft und Psychoanalyse, Düsseldorf/Zürich: Walter.
Tomasello, Michael (2010): Warum wir kooperieren, Berlin: Suhrkamp.
Wohlleben, Peter (2015): Das geheime Leben der Bäume. Was sie fühlen, wie sie kommunizieren – die Entdeckung einer verborgenen Welt, Ludwig: München.
Ziese, Peter (1982): Die Triebtheorie der Psychoanalyse, in Eicke, Dieter (Hg.): Tiefenpsychologie, Band 1: Sigmund Freud – Leben und Werk, Weinheim und Basel: Beltz, S. 337-356.
Internetabfrage: 25.5.2024
Bitte zitieren als:
Peglau, Andreas (2024): Menschenbilder: gut geboren, böse gemacht (https://andreas-peglau-psychoanalyse.de/menschenbilder-gut-geboren-boese-gemacht/)
Tipps zum Weiterlesen:
Sind wir geborene Krieger? Zu psychosozialen Voraussetzungen von Friedfertigkeit und Destruktivität