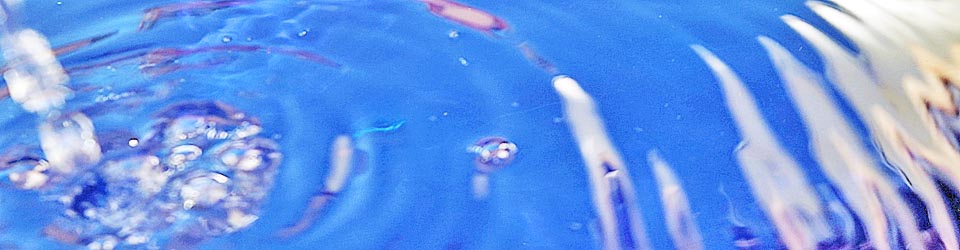von Andreas Peglau

Anfang November 2025 ist Philipp von Beckers Buch „Der neue Glaube an die Unsterblichkeit“ in dritter, verbesserter und um ein Vorwort erweiterter Auflage erschienen. Schon als es 2015 erstmals veröffentlicht wurde, betraf es eine brisante, hochproblematische gesellschaftlich-politisch-wissenschaftliche Entwicklung. In den vergangenen 10 Jahren ist diese Entwicklung nahezu explodiert.
Das drückt sich nicht zuletzt darin aus, dass die Top 10 der reichsten und damit zugleich einflussreichsten Menschen 2015 noch mehrere Besitzer klassischer Industrie- und Warenhauskonzerne umfasste. Heute kommen, so von Becker im Vorwort, acht dieser Superreichen nicht nur „aus dem Techsektor“, sondern sind allesamt „Anhänger transhumanistischer Vorstellungen und auf der Suche nach dem heiligen Gral der künstlichen ‚Superintelligenz‘“. Angeführt wird die Rangliste nun von Elon Musk, der sich 2015 noch nicht einmal so exponiert hatte, dass von Becker ihn in seine Betrachtungen hätte einbeziehen müssen.
Veraltet ist dieses Buch dennoch in keiner Weise. Denn von Becker stellt grundsätzliche Fragen, an denen sich nichts geändert hat. Wie realitätsnah ist die Idee, menschlichen Geist auf Maschinen bzw. tote Materie zu übertragen? Lässt sich das in Übereinstimmung bringen mit biologischen Gesetzen, mit der Evolution menschlicher und anderer Lebewesen, mit der „Verantwortung für unseren blauen Planeten Erde“? Welche wissenschaftliche Grundlage hat der Transhumanismus, wer hat ihn erfunden und welchen Zielen dient er? Könnten künstliche „Intelligenzen“ die vielfältigen Probleme auf unserem Planeten lösen? Geht es wirklich darum, die Erdbevölkerung zu beglücken – oder vielmehr darum, dem „Egowahn“ Einzelner zu frönen, auf Kosten ohnehin unterdrückter Massen?
Von Becker, Jahrgang 1979, vielseitig interessierter Autor und Filmemacher, fragt nicht als Technikfreak oder Insider, sondern als kluger Sozialkritiker. Und er gibt ebenso stringente wie nachvollziehbare Antworten.
So erinnert er bezüglich der technischen Machbarkeit daran, dass die „über 100 Milliarden Neuronen“ im Menschenhirn durch etwa 1000 mal 1000 Milliarden sich permanent verändernde synaptische Verbindungen verknüpft sind. (Ganz abgesehen davon, dass schon die Hypothese „Gehirn = Geist“ äußerst fragwürdig ist und Forscher auch von „Bauch“-, Darm- oder Herz-Intelligenz sprechen. Außerdem: Noch niemand hat „die Psyche“ gesehen; „Geist“, „Seele“, „Persönlichkeit“ sind nur einige jener schwammigen Begriffe, mit denen versucht wird, etwas noch immer letztlich Unerklärbares wenigstens verbal zu erfassen.)
Nahezu prophetisch war es, dass von Becker bereits in der ersten Auflage auf „virtuelle Realitäten“ verwies, deren „Suchtpotential wohl unermesslich groß“ sei. Dort könne man zwar „verschwinden“, aber keine reale Befriedigung finden, da Letztere wohl nur entstehe, „wenn sie einem wirklich widerfährt und nicht, wenn sie einem nur zur Verfügung gestellt wird“. Doch die insbesondere durch steigende Arbeitslosigkeit und Verelendung voranschreitende Isolation zahlloser Individuen intensiviert das Interesse an Ersatz“beziehungen“. Kürzlich wurde bekannt, dass Hunderttausende inzwischen Chatbots sogar für „Gespräche“ über von ihnen in Erwägung gezogenen Suizid nutzen.
Von Becker belegt durch Zitate die persönlichen Motive führender Transhumanisten wie den größenwahnsinnigen, narzisstischen „Traum, alle unerfüllten Sehnsüchte zu befriedigen“ oder die Angst vor dem Tod zu verdrängen. „Musk, Bezos und Zuckerberg“, waren, mutmaßt er, „traumatisierte Kinder“, welche ihre seelischen Verformungen nun kompensieren durch „Männerphantasien von Eroberung, Unterwerfung und Kontrolle“.
Aber von Becker bleibt dabei nicht stehen, psychologisiert nicht: „Ihre Antriebe und ihr Handeln sind Ausdruck einer kranken, patriarchalisch-kapitalistischen Kultur.“ Er beschreibt, wie Transhumanismus und „KI“-Gläubigkeit sowie die durch sie stimulierte Güterproduktion neoliberalen Kapitalismus, Medienmanipulation und Militarisierung vorwärtstreiben: Aspekte, deren Bedeutung gegenüber 2015 erschreckend gewachsen ist. Doch schon damals hoffte das Pentagon auf implantatgesteuerte Soldaten, die „bis zu sieben Tage wach bleiben können“, musste von einem „militärisch-informationellen Komplex“ gesprochen werden, „dessen mächtigster Akteur im Privatsektor des Unternehmen Google ist“.
Hinzu kommt, dass für Menschen mit anerzogenen autoritären Charakterstrukturen – also für die allermeisten von uns – gerade ein modernes Übervater-Angebot entsteht:
„Mit der digitalen Überwachungsmacht formiert sich ein neues Überwachungs-, Bestrafungs- und Belohnungsregime, gleich einem allmächtigen, allsehenden (christlichen) Gott.“
Von Becker ist kein Maschinenstürmer. Er anerkennt durchaus das positive Potential immer schneller werdender Rechenmaschinen (mehr ist jedenfalls meines Erachtens auch der schönste Computer nicht). Doch er lässt keinen Zweifel daran, dass sich dieses Potential unter kapitalistischen Verhältnissen nicht entfalten kann.
Auch die „Digitalisierung“ stellt uns also vor Systemfragen.